
Unser wöchentlicher Podcast über das Leben, die Musik und alles, was dazugehört.
35. Folge: Wolfgang Frömberg im Gespräch mit Clemens Orth, Jazz-Pianist, Betreiber des Salon de Jazz sowie Gastgeber einer eigenen Reihe im King Georg Jazz-Club.
Ein ganz besonderes Jazz-Duo: Moses Boyd und Binker Golding aka Binker & Moses geht es nicht um einen Bruch mit der englischen Jazz-Tradition, sondern um eine musikalische Evolution. Eine Modernisierung des Sounds.

Es kann einem ein wenig schwindelig werden, wenn man auf die Londoner Jazz-Szene schaut. Wie viele Platten, und wie viele herausragende darunter, in den letzten sieben Jahren dort entstanden sind und veröffentlicht wurden? Was besonders auffällt: Der Strom an hypertalentierten Musiker*innen flaut gar nicht ab. Den Drummer Moses Boyd darf man, nein, muss man dennoch herausheben. Der 31-jährige Londoner, der erst als Teenager mit dem Schlagzeug-Spiel begann, hat längst einen Großteil der gleichaltrigen Musiker*innen hinter sich gelassen. Trotz seines vergleichsweise jungen Alters kann er schon unzählige Awards sein Eigen nennen – vom renommierten MOBO (Music Of Black Origin) bis zum Jazz-Preis des House of Parliament des United Kingdoms ist alles dabei, was man so abstauben kann. Die eine Hälfte davon hat er alleine beziehungsweise als Bandleader des Moses Boyd Exodus gewonnen; die andere in einem ganz besonderen Duett: Binker & Moses.
Das neue Album »Feeding The Machine«
Da heißt sein Pendant Binker Golding. Boyd und der sechs Jahre ältere Golding lernten sich als Teil der Tomorrow’s Warriors des britischen Bassisten Gary Crosby kennen und lieben. Sie verbindet zum Beispiel das offene Auge und Gehör für Jazz-fremde Musik. Während Boyd seit jeher und bis heute ein großer Liebhaber von (englischem) Rap, Drill und Grime ist, war die erste (musikalische) Liebe des Saxofonisten die Rock-Band Guns’n’Roses. Dieses rockige Moment hat er bis heute bewahrt, immer wieder sticht es in seinen Parts durch, seine Riffs gleiten dann vom Holzbläser scheinbar über zur elektrisch-verstärkten Gitarre und ihren Effekten. Dieses wütende, grobe Geschrammel nutzt Golding indes nur selten, wenngleich sein gesamtes Spiel robust daherkommt. Dass er es auch anders kann, das beweist er exemplarisch auf dem neuen Album »Feeding The Machine«.
Hier tobt sich Golding aus, sein Saxofon läuft meist durch Echo-Effekte, was dem ganzen Spektakel ein nebulöses-dunstiges Antlitz verleiht. Er nutzt diese Nebelwände dann, um die spirituellen und musikalischen Seelen seiner Vorgänger zu erwecken. John Coltrane blickt aus dem Jenseits herüber, Sonny Rollins’ Bass grüßt aus dem Diesseits, Albert Aylers Gewalt aus dem Nirwana – alles, wie bereits erwähnt, robust. Doch auch feingliedrig kann er, der Golding. Dann mimt er den eigentlich unvergleichlichen Evan Parker; die Parts gleichen naturbezogenen, impressionistischen Gemälden. Verwoben wird alles durch das aktive, dynamische Spiel von Moses Boyd; neben den Beats des Hip-Hop und den Riddims der afro-karibischen Musik spielt Boyd seine Felle und Bleche fast schon romantisch, immer auf der Suche nach dem richtigen Klang. Fürsorgliche Wirbel, knisternde Crashes, zündelnde Ideen.
Tiefe Kenntnisse der Jazz-Vergangenheit
Boyd und Golding geht es nicht um einen Bruch mit der englischen Jazz-Tradition, sondern um eine Evolution, um eine Modernisierung des Sounds; man nennt das im Englischen auch gerne »genre-bending«. Hier soll die prozessuale Kunst der Improvisation – das Duo ist in einem viskosen Semi-Free-Jazz zu Hause – und der Jazz-Komposition kurzgeschlossen werden mit der musikalischen Vielfalt des postkolonialen Londons. Es geht um ein Abbild des Reichtums an Einflüssen, mit denen man heutzutage aufwächst. Sie untersuchen die verschiedenen Musikszenen Londons (Cafe Oto-Avantgarde, afrokaribische Spielarten, Dub, aber auch Afro-Beat und Rock) und verleiben sie sich allesamt ein. Binker & Moses sind eine Bestandsaufnahme des Szene-Reichtums der Hauptstadt – Szenen, die ehedem getrennt voneinander agierten und durch die »Londonisierung« der Musikszene (Schließungen von Clubs und Konzertorten, keine Selbstverwaltung etc.) langsam aber sicher zusammenrücken mussten, um die wenigen Orte gemeinsam zu bespielen.
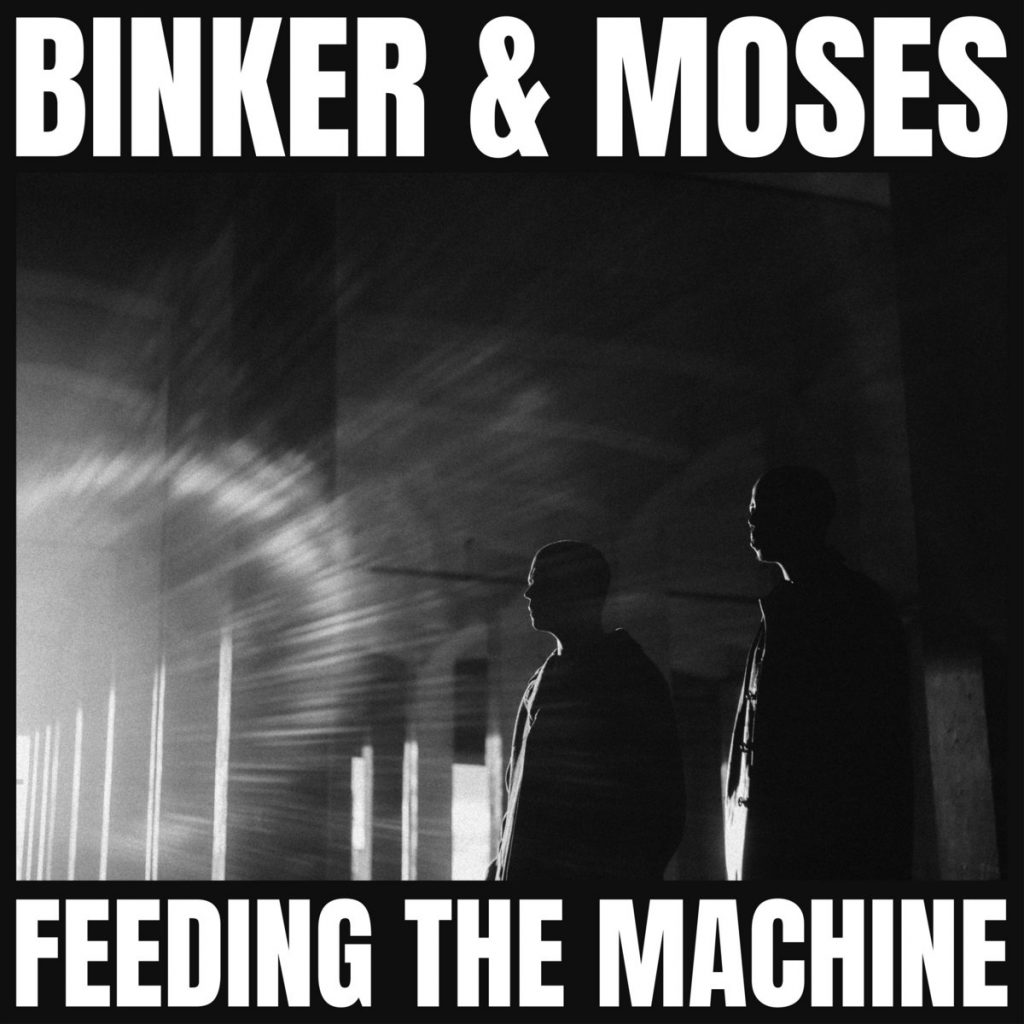
Das Fundament ist stets Jazz, die beiden sind hochgeschult und haben tiefe Kenntnisse der jazzologischen Vergangenheit. Unterdessen bleiben sie Kinder ihrer Zeit – was ihre Musik, wie zuletzt auf »Feeding The Machine« so hochbrisant macht. Wie kaum ein anderes zeitgenössisches Duo wissen Binker & Golding zu begeistern, umzuhauen, mitzureißen. Es ist eine Musik, die selbst in einer Stadt wie London meilenweit vor den Alben aller anderen zu stehen scheint. Schlicht und ergreifend die aufregendste Musik der letzten Jahre.
Text: Lars Fleischmann
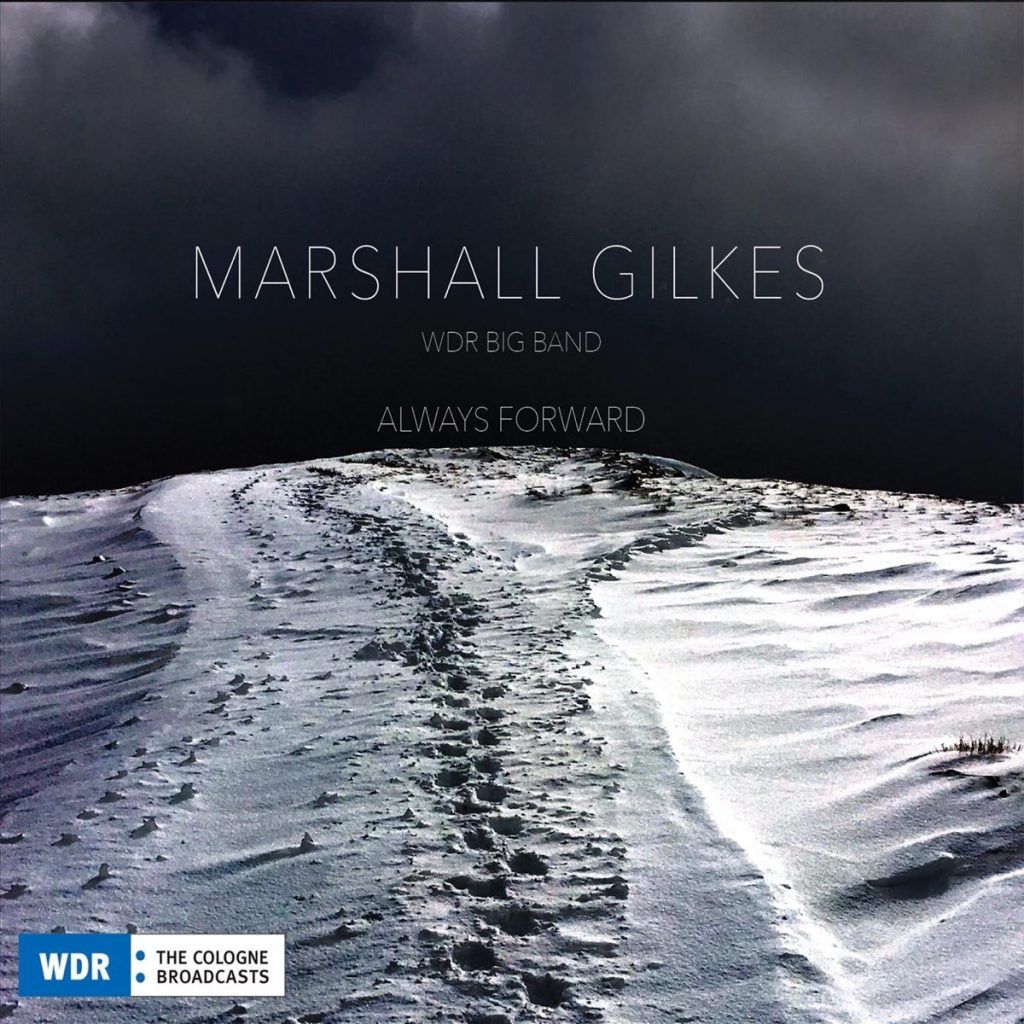
Posaunist, Komponist und Arrangeur Marshall Gilkes ging nach vier Jahren als Mitglied der WDR Big Band Ende 2013 zurück nach New York. 2015 erschien dann sein Album »Köln« in Zusammenarbeit mit der WDR Big Band, das für einen Grammy nominiert wurde (siehe JP04/15). War »Köln« schon eine höchst überzeugendes Big Band-Album, zeigt »Always Forward« mit Aufnahmen vom September 2017 eine deutliche Weiterentwicklung. Gilkes‘ Kompositionen zeichnen sich durch melodischen Gehalt aus. Seine Arrangements bestechen mit geschickter Verbindung von satten Bläsersätzen und Solo-Stimmen, schöpfen den Reichtum an Klangfarben der WDR Big Band voll aus und lassen die Solisten der WDR Big Band leuchten, etwa die Altsaxofonisten Johan Hörlén in »Easy to Love« und Karolina Strassmayer in »Switchback«. Auch John Goldsby brilliert mit wohlgesetzten Bass-Tönen hinter Andy Haderers Flügelhorn in »Portrait of Jennie«. Gilkes selbst gibt sich erfreulicherweise etwas mehr Raum als Solist als auf »Köln«. Es gibt wahrlich nicht viele Posaunisten weltweit, die ein Tour de Force-Solo spielen können wie Gilkes im ersten Stück »Puddle Jumping«. Sein wunderbarer Ton mit der exakt richtigen Mischung von Weichheit und Attacke über den gesamten Frequenzbereich des Instruments, seine atemberaubende Technik im Dienste der Musik, seine Musikalität vom Schwelgen in der Melodie bis zum Einsatz der Posaune als Rhythmusinstrument kommen optimal zum Ausdruck.
Text: Hans-Bernd Kittlaus

Musiker*innen, Künstler*innen, DJs und andere Kulturschaffende unterhalten sich anhand von zehn ausgewählten Platten über ihre Musikleidenschaft und ihr Leben.
Achte Folge: Hermes Villena im Gespräch mit der bildenden Künstlerin und Grafikdesignerin Parissa Charghi
Ein Gespräch mit Bassistin, Komponistin und Bandleaderin Ursula Wienken über ihren musikalischen Werdegang, das URS Quartett, künstlerische Einflüsse und die Wichtigkeit professioneller Räume für junge Musiker*innen.

Die 20-jährige Ursula Wienken aus Neuss ist Bandleaderin des URS Quartett, das am 30. März 2022 im King Georg innerhalb der »Young Talents«-Reihe eines seiner ersten Konzerte spielt.
Wienken wird an dem Abend am Kontrabass stehen und von da aus mit ihren drei Bandkollegen – Frederik Hesse (Trompete, Flügelhorn), Moritz Petersen (Piano) und Jakob Görris (Schlagzeug) – eigene Kompositionen zum Besten geben. An diesem Abend gesellt sich außerdem die Sängerin Donya Solaimani dazu.
Wie kommst Du zur Musik?
Meine Eltern betreiben Musik als Hobby. Mein Vater spielt akustische Gitarre, meine Mutter hat viel Chorerfahrung und spielt Klavier. Ihnen war es wichtig, ihren Kinder eine musikalische Ausbildung anzubieten. Der Unterricht lief dann über die Schule, zuerst mit der Gitarre, und auf dem Gymnasium wechselte ich zum E-Bass. Ich war dann in der Big Band-AG. Zum Studium hin fing ich auch mit dem Kontrabass an, hatte dann meinen Vorbereitungskurs hier in Köln, fing in Rotterdam mit dem Studium an und wechselte nach Köln. Bald beginnt das vierte Semester.
Deine Eltern sind jetzt nicht akademisch geschult. Wie kam es bei Dir zu der Entscheidung, einen akademischen Weg einzuschlagen?
Mein Bruder, der acht Jahre älter ist, hat schon in Arnheim Schlagzeug studiert. Das war ein wichtiger Einfluss für mich. Und ein Jahr vor dem Abi habe ich hier in Köln auch an der Offenen Jazzhaus Schule bei André Nendza das Vorstudium angefangen. Da habe ich mir vermehrt die Frage gestellt, ob ich das Studium machen möchte – und habe mich dafür entschieden.
Du hast mit dem Kontrabass erst vor relativ kurzer Zeit begonnen. Merkst Du schon, wie sich E-Bass- und Kontrabass-Spiel beeinflussen oder verändern?
Das sind für mich, ehrlich gesagt, komplett unterschiedliche Instrumente. Der Kontrabass birgt für mich viel mehr Herausforderungen, hat mich gleichzeitig aber auch weiter weg von Pop-Musik gebracht, die ich dann eher auf dem E-Bass spiele. Aber: Mittlerweile spiele ich auch häufiger Jazz auf dem E-Bass. Das ist bereits passiert. Das Spielgefühl ist halt sehr unterschiedlich. Der Kontrabass ist ganz nah am Körper und resoniert. Man spürt die Vibrationen. Das macht einen wichtigen Unterschied für mich. Derzeit präferiere ich den Kontrabass auf alle Fälle. Gerade auch der Unterricht bei Dieter Manderscheid hat mich sehr für den Kontrabass begeistern können.
Der Kontrabass hat immer noch den Ruf als »Underdog«-Instrument. Ist das etwas, womit Du dich konfrontiert sehen?
Also für jemanden, der*die hier in Köln in einer wahnsinnig tollen Bass-Klasse ist, natürlich nicht. (lacht) Vor allen Dingen in der Arbeit mit der Band merke ich aber schon, dass man am (Kontra-)Bass anders komponiert und arbeitet. Dadurch werde ich, die sich weniger um die melodischen Ausarbeitungen kümmert, dann zu einer Art »Aufgabenerteiler*in« oder »Projektmanager*in«. Als Rhythmusgruppeninstrument hat man gleichzeitig sowieso ein großes Verantwortungsgefühl für die Band, die Stücke; den Blick dafür, wie man alles zusammenhält und rund macht. Es funktioniert zumindest gut als Bassist*in und Bandleader*in.

Du bist die dezidierte Bandleaderin beim URS Quartett…
… ja, genau. Gleichzeitig verstehen wir uns eindeutig als Band und nicht bloß allein als Ensemble. Mitspracherecht ist total wichtig für uns.
Mir scheint Euer musikalischer Ansatz sehr breitgefächert zu sein. Ich erkenne da sowohl Straight Ahead als auch neuartige Ausformungen.
Ich denke, dass bei uns diese flächigen, schwebenden Phasen maßgebend sind. Dazu gesellen sich wiederum energiereiche und überraschende Momente. Wir arbeiten mit zwei Begriffen: Das Träumerische und das Überraschende. Das versuchen wir stets zu verbinden. Wir wollen das Aufeinandertreffen und die Begegnung dieser beiden Ansätze. Es ist dennoch schwierig das unter einer Genre-Bezeichnung zusammen zu fassen. »Semi-Straight-Ahead« – was würde das bedeuten?
Welche Einflusssphäre siehst Du denn für sich?
Unsere Musik ist ganz klar von europäischen Musiker*innen geprägt. Kenny Wheeler, John Taylor, Norma Winston – oder hier aus Deutschland und Köln: Florian Ross. Gleichzeitig wollen wir aber nicht die amerikanischen Wurzeln des Jazz vergessen, die ja eindeutig mit der afro-amerikanischen Geschichte verbunden sind. Für uns ist das auch ein fragiles Thema, gebe ich zu. Wir wollen nicht den Stempel: Wir spielen nur die Musik weißer Europäer*innen. Zugleich sagen wir aber: Wir machen European Modern Jazz – und das löst einige Themen des US-amerikanischen Jazz eben nicht ein.
Das ist eine sehr konkrete Haltung zu dem Themenkomplex.
Da hat mich der offene und konzentrierte Diskurs an der Hochschule – unter anderem das Seminar »Black Atlantic« – eindeutig mitgeprägt. Auch ich, als weiße Musiker*in in Deutschland, hinterfrage natürlich meine Haltung zur Musik von Schwarzen Musiker*innen, die unter ganz anderen Umständen aufgewachsen sind und musiziert haben. Da gibt es an der HfMT auf jeden Fall Räume für den Diskurs, wie eben in solchen Seminaren.
Kommen wir zum Schluss zum Konzert im King Georg, eines deiner ersten in einem professionellen Rahmen. Glaubst Du, dass solche Orte und Möglichkeiten wichtig sind?
Ich finde es sehr gut, dass es das King Georg und die Reihe »Young Talents« gibt. Ich glaube man sollte immer hinschauen, dass der Unterschied zwischen Studierenden einerseits und Berufsmusiker*innen andererseits nicht zu hoch gehangen wird. Wir sind alle Musiker*innen. Da ist ein Zugang zu professionellen Orten super. Zu häufig trifft man als Studierende auf Zusammenhänge, bei denen vielleicht die Ernsthaftigkeit etwas auf der Strecke bleibt.
Dazu kommt natürlich, dass das King Georg sowieso ein interessanter Ort ist. Wo man am Wochenende auch für wenig Geld Tanzen gehen kann. Ich glaube, das ist auch für Menschen interessant, die sich (noch) nicht für Jazz interessieren.
Interview: Lars Fleischmann

Selbst Eingeweihten sagt der Name Jothan Callins vergleichsweise wenig. Callins hat als Side- und Bandman in verschiedenen Konstellationen gespielt, landete auch bei B.B. King und Stevie Wonder, dennoch sind seine diskografischen Beiträge spärlich gesät. Einen großen Teil seiner Musikkarriere verbrachte er als Dozent und Lehrer – und vier bedeutende Jahre auch beim Sun Ra im Arkestra. Es sollten die letzten vier Jahre des charismatischen Jazz-Innovators und »Alien auf Durchreise« Sun Ra sein. Callins und ihn verband, dass sie beide in Birmingham, Alabama geboren wurden. Sun Ra 1914, Callins 28 Jahre später. Das berüchtigte Zentrum der Segregation und rassistischen Unterdrückung der Schwarzen Bevölkerung brachte die Musiker hervor – natürlich sind sie jeweils Autodidakten gewesen.
Vor seiner Zeit im Arkestra (ab 1989) war Callins natürlich dennoch auch abseits der Musikschule unterwegs. Das einzige Artefakt dieser Zeit ist diese Platte, die nun vom portugiesischen Label »Mad About« nach 50 Jahren wiederveröffentlicht wird. »Winds Of Change« und hat weder mit den Scorpions noch mit dem Mauerfall zu tun. Nein, die Winde, die hier den Wandel bringen, sind spirituelle, musikalische, frei blasende und pustende.
Es ist die Aufnahme einer Session in New York, 1972. Neben Callins, der hier als Trompeter auftritt (er spielte in seiner Karriere auch noch Kontrabass), bilden Roland Duval (Percussion), Norman Connors (Drums), Joseph Bonner (Piano, Tambourin) die Besetzung. Der bekannteste Name ist Cecil McBee. Den Kontrabassist kennt man vor allen Dingen als Sideman für Wayne Shorter, Yusef Lateef, Alice Coltrane und unzählige weitere.
Es ist gewissermaßen eine bande à part, eine Gruppe außerhalb des Scheinwerferlichts, fernab der großen Hall of Fame. Dennoch: »Winds Of Change« ist eine hervorragende Spiritual Jazz-Platte, nicht überbordend, sondern der Sache verpflichtet. Gelegentlich taucht man in Träumereien ab, meist aber spielt man einen vertrauten Strata-East-Sound. Für seine Zeit fast schon konservativ erscheint der Opener »Prayer For Love and Peace«, das Chaos setzt erst im Titelstück ein. »Sons And Daughters Of The Sun« ist supergeschmeidig; trotz ordentlicher Dynamik in der Rhythmus-Sektion. Auch der Closer »Triumph: Invitation« schiebt kräftig an. Es ist immer wieder schön anzuhören, wie hier die verschiedenen Instrumente auseinander laufen und dann wieder zusammenkommen. Was soll man sagen: Die B-Mannschaft versteht ihr Handwerk. So ist diese Reissue vor allen Dingen eine Aufforderung an uns Hörer*innen, auch mal abseits der großen Prachtboulevards zu suchen und Nischen auszutesten. Es warten noch unzählige Werke à la »Winds Of Change”, die wiederentdeckt wollen.
Text: Lars Fleischmann
Die Mundharmonika im Jazz ist untrennbar mit dem Namen Toots Thielemans verbunden. Auch Hendrik Meurkens, unser Gast im Club am kommenden Dienstag, den 8. März steht als wichtigster Mundharmonika-Spieler seit Toots in seiner Nachfolge und hat mit ihm selbst gespielt. »Bluesette« ist eine sehr bekannte Komposition von Toots Thielemans, der als großartiger Musiker neben der Mundharmonika Gitarre spielte und Sänger und Pfeifer war und eben auch sehr viel komponierte. Hier zum Start eine Aufnahme der 1964 von ihm komponierten »Bluesette« aus dem Jahr 2009 aus Rotterdam.
Ursprünglich war das Original von 1964 allerdings eine Kombination seines Gitarrenspiels und seiner Fähigkeit »zu pfeifen«.
Norman Gimbel hat später einen Text dazu geschrieben:
Poor little, sad little blue Bluesette
Don’t you cry, don’t you fret
You can bet one lucky day you’ll waken
And your blues will be forsaken
Some lucky day lovely love will come your way
If there is love in your heart to share
Dear Bluesette, don’t despair
Some blue boy is waiting just like you
To find a someone to be true to
Two loving arms you can nestle in to stay
Get set, Bluesette
True love is coming
Your lonely heart soon will be humming
Pretty little Bluesette, musn’t be a mourner
Have you heard the news yet? Love’s ‚round the corner
Love wrapped in rainbows and tied with pink ribbons
To make your your next springtime your gold wedding ring time
»Bluesette« wurde wortwörtlich hundertfach gecovert, u.a. von Chet Atkins, Bill Evans, Sarah Vaughan und Anita O’Day. Hier die Aufnahme mit Sarah Vaughan
Thielemans beschäftige sich viel mit südamerikanischer Musik. Hier eine wundervolle Aufnahme von »Bluesette« mit der brasilianischen Sängerin Elis Regina aus dem Jahr 1969
Toots´ Mundharmonika bestimmte den Soundtrack von Filmen wie z.B. »Midnight Cowboy« (2012)
…und nicht zuletzt den Abspann der TV-Serie »Sesamstraße«
Wenn das alles Spaß macht, der wird auch die Ausschnitte aus der David Letterman Show 1982-1985 genießen – und mit Sicherheit auch das Konzert am kommenden Dienstag mit Hendrik Meurkens im King Georg.

Jochen Axer, Unterstützer des King Georg und über die Cologne Jazz Supporters Förderer vieler weiterer Jazz-Projekte, stellt hier jeden Sonntag einen seiner Favoriten vor.
Über 50 Jahre Bandgeschichte, ein halbes Jahrhundert Genre-sprengender Jazz. Es lohnt sich immer, in das Werk des Art Ensemble of Chicago reinzuhören.

Sich über Lieblingsplatten zu streiten ist ein mühseliges, dennoch durchaus beliebtes Hobby. Wo zwei oder drei unter einem Namen – ob beispielsweise Beatles, Miles Davis oder Coltrane – zusammen kommen, da wird auch gestritten. Im Falle einer der wichtigsten Combos der Jazzgeschichte wird das Unterfangen gleichsam zur Belastungsprobe: Das Art Ensemble of Chicago blickt auf mindestens 50 LPs zurück – und wer weiß wie viele ungesichtete Aufnahmen noch in Kellern alter Jazzclubs warten. Betrachten wir also kurz Blick auf die Geschichte des Ensembles. Während andere Karriere Hochs und Tiefs durchziehen, müssen dabei für das Art Ensemble of Chicago andere Maßstäbe angelegt werden. Seit 1965 musiziert man unter diesem Namen in gewohnter Regelmäßigkeit; neumodische Begriffe wie »Projekt« laufen dennoch ins Leere. Die Band ist immer eine Band geblieben. Es waren aber auch stürmische Zeiten, als sich die Ursprungsformation fand.
In der »Windy City« braut sich was zusammen
In der »Windy City« am Lake Michigan brodelte es schon länger: In Detroit buchte man mit Motown Charts-Plätze en masse, in New York versammelte sich die Elite des Jazz, um sowohl den Hard-Bop als auch den gerade brachial einschlagenden Free-Jazz zu perfektionieren. Und in Chicago … passierte vor allen Dingen für die afro-amerikanischen Musiker*innen nicht viel. Aushängeschild war Chess Records – und dieses Label wartete bereits seit zehn Jahren auf eine Nummer, die mehr als eine Million Platten verkaufen konnte. Das sollte sich schlagartig ändern, als die 25-jährige Sängerin Fontella Bass mit »Rescue Me« einen der besten R&B-/Soul-Songs aller bisherigen Zeiten herausbrachte. Fontella Bass war außerordentlich begabt; nicht bloß Stimmband, sondern eine stolze und schlaue Künstlerin. »Barry Gordy-hafte« Geschäfte waren mit ihr nicht zu machen. Viel mehr interessierte sich die Sängerin neben der eigenen Karriere noch für die »Clique«, in der sich ihr Mann Lester Bowie aufhielt. Dieser war gerade Teil des Association for the Advancement of Creative Musicians (kurz AACM) geworden: Ein loser, aber äußerst produktiver Zusammenschluss von Chicagoer Künstler*innen. Ein Kollektiv, ein Interessenverband, ein Nährboden, auf dem schon bald die ersten Blüten sichtbar werden sollten. Clubs und Bars schlossen sich zusammen, Künstler tauschten sich aus, eine Community entstand. Phil Cohran und Maurice McIntyre waren nur zwei von vielen Beteiligten.
Um den umtriebigen Holzbläser Roscoe Mitchell formierte sich nun ein Sextett, das neben ihm und Lester Bowie, aus Joseph Jarman, Malachi Favors und Phillip Wilson bestand. Im Mittelpunkt stand die Frage, was Jazz überhaupt leisten könne. Zwar lehnte man den Free-Jazz nicht ab, doch krempelte das Sextett, das 1968 zum Art Ensemble of Chicago wurde, ihn einfach um. Es verband die freie Spielart mit kompositorischen Kniffen, bediente sich sowohl bei der Neuen Musik eines Arnold Schönberg und den künstlerischen Stücken eines John Cage als auch bei den Vorgängern des Jazz bis hin zu den Roots, die auf den Feldern der Südstaaten als auch in der afrikanischen Herkunftsländer der Ahnen lagen. Ein Meisterwerk der an Meisterwerken nicht armen Diskografie ist der Soundtrack »Les Stances a Sophie« zum gleichnamigen Film von 1970. Die Band hatte es ab 1969 nach Europa und im Speziellen nach Frankreich verschlagen. Das Instrumentarium – genauso wie Bühnenoutfits, Melodik und Rhythmik – war derweil eindeutig vom afrikanischen Kontinent beeinflusst.
Die Staaten waren zu klein geworden für das Ensemble, das sich mit berauschender Geschwindigkeit weiterentwickelte. Über 33 Minuten spielt sich die Band auf der Platte in einen wohlgepflegten Rausch. Schon der Opener »Theme de Yoyo« zeigt die Wucht einer Band, die sich nicht etwa auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigt, sondern gegenteilig agiert. Die Eigenheiten des Spiels werden gepflegt, konzentriert und kultiviert. Hier hört man – wie auf so vielen Aufnahmen bis weit in die 1990er Jahre hinein – eine Formation, die jede Grenze zu sprengen vermag. Afrikanisch-pentatonische Bläsersätze wechseln sich ab mit Neo-Dixie-Sounds, Free-Form und Bop – und dazu singt eben Fontella Bass, die während des selbstgewählten Exils in Europa Teil der Band wurde. Doch der Blick zurück ist nie ein wehmütiger. Kurz vor dem Ende der Platte ertönt für drei Takte eine Reminiszenz auf »Summernight« aus »Porgy & Bess«. Nicht nur die erste US-amerikanische, sondern auch – gleichwohl von einem amerikanischen Juden geschriebene – eine durch und durch afroamerikanische Oper.
Eine Monografie reicht nicht aus
Verortet, wenn das Art Ensemble of Chicago nicht sogar das Genre mitbegründet hat, wird das alles im Avantgarde-Jazz. Gleichzeitig war nie es wirklich das Ziel, eine Avantgarde zu formieren. Die Grenzen des Jazz wurden vielfach gesprengt und weiterentwickelt, doch das folkloristisch-musikalische Erbe war im gleichen Maße Aufhänger für die stetige Evolution des Sounds. »Message to our Folks« nannte Paul Steinbeck seine mittlerweile fast zehn Jahre alte Monografie zum Art Ensemble of Chicago. Ein grandioses Buch, das dennoch – bei über 300 Seiten Umfang – kaum in der Lage ist das gesamte Werk einzuordnen. Einige Verbindungen sind jedoch offensichtlich: Idris Ackamor und The Pyramids sind unmittelbar beeinflusst wurden, Sun Ra wahrscheinlich mittelbar.
Angesichts von über 50 Jahren Bandgeschichte sind einige Wechsel und auch schmerzhafte Verluste zu beklagen. Aus der Stammformation ist nur noch Roscoe Mitchell übrig. Lester Bowie starb 1999, Malachi Favors 2004. Don Moye sitzt derweil auch schon seit fünf Dekaden am Schlagzeug. Gerade im Mainstream wird das Art Ensemble of Chicago gerne übersehen, doch für Jazzfans lohnt es sich immer, reinzuhören in die faszinierende Diskografie
Text: Lars Fleischmann, Foto: Tore Sætre/ Wikimedia