
Musiker*innen, Künstler*innen, DJs und andere Kulturschaffende unterhalten sich anhand von zehn ausgewählten Platten über ihre Musikleidenschaft und ihr Leben.
Zwölfte Folge: Lars Fleischmann im Gespräch mit dem Journalisten, Übersetzer und DJ Stephan Glietsch aka Earl Orlog.

Eine Fotografie: Ein Gewerbekomplex, Blech auf Stahlskeletten. Von unten nach oben sieht man einen Unterstand; eine Halle, die ein U formt; eine Gangway; ein Lüftungsrohr vermutlich; ein weiteres, diesmal in Blau; links postmodern-brutalistische Beleuchtungs- und Belüftungslöcher; wieder eine Gangway und ein Dach … Die Fotos des belgischen Fotografen Filip Dujardin sind bisweilen architektonische Verwirrspiele gegen die das Centre Pompidou in Paris wie ein Einfamilienhaus wirkt. Mithilfe digitaler Technik baut Dujardin in seinen andauernden Serien »Fictions« und »Impossible Architectures« solche, durchaus an M.C. Escher erinnernden, Gebäude aus Versatzstücken alter und neuer Industrie- und Gewerbebauwerke. Es entstehen Vexierbilder: Ist das nun real und möglich; oder doch nur eine surrealistisch-verstellte Fantasie und Fiktion?
Dujardins belgischer Landsmann Joachim Florent nahm sich in den letzten Jahren diese Fotografien immer wieder zum Anlass – vielleicht sogar zum Beispiel – um kleinere, geometrische Piano-Figuren am Klavier zu komponieren. Florent ist nicht nur ein Europa-bekannter Kontrabassist, sondern auch Physiker, was ihn in das französische Nantes verschlagen hat. Er sagt: »Ich bin zwar vergleichbar schlecht am Klavier, aber ich sitze trotzdem jeden Tag da und komponiere.« Bei diesen Übungen entstand das Material, das sich heute auf »Designers«, dem Debütwerk des gleichnamigen Trios, wiederfindet.
An Joachim Florents Seite stehen bei Designers der australische Drummer Will Guthrie, der ebenfalls in Nantes wohnt, und der finnische Pianist Aki Rissanen. Beide ließen sich auf das Experiment ein:
»Es war 2019 als ich anfing diese kleinen Studien zu produzieren, die eben eine geometrische Qualität besaßen«. Florent empfand eine einerseits mathematische, andererseits architektonische Songstruktur als interessante Herausforderung.
Hört man in »Engrenages«, dem Nabelstück des Albums, rein, fallen einem gleich die Pagoden-haften Piano-Arpeggios und -Ostinati auf, die in der Manier der Minimal Music hochsteigen und runterfallen, dabei markante Dach-Formationen (um in der Sprache der Architektur zu bleiben) bilden. Doch das ist nicht alles, was wir hören: Plötzlich befreit sich das Piano aus der Wiederholung und löst Akkorde hochdekorativ auf. Ganz klar: Das ist nicht geschrieben, sondern improvisiert.
Die Vermutung bewahrheitet sich, denn Florent hat nicht ganz ohne Hintergedanken Guthrie und Rissanen mit an Bord geholt, gelten beide doch als exzeptionelle Improvisateure.
Bevor man sich zu lange mit dem Spiel aus Komposition und Improvisation auseinandersetzen kann, geht es doch in fast halsbrecherischer Geschwindigkeit weiter; die Pause währt nur kurz. Ab jetzt spielen alle drei mit ordentlich Druck los. Nicht nur das Piano hetzt von Note zu Note, Guthrie trommelt fröhlich-wild und besenschwingend auf Hi-Hat und Snare rum, während der Kontrabass in Florents Händen Kapriolen schlägt.
Auch hier löst sich das Spektakel bald in »Luft« auf: Kontrabass und Schlagzeug teilen sich jetzt das Spotlight, gehen Hand in Hand in die Tiefe des Tracks. Mit ordentlich Swing auf der Führhand begleitet Will Guthrie formidable Kontrabass-Linien. Nach einem letzten Aufruhr endet das Lied erstmals … es könnte gleichwohl immer so weiter gehen.
Klar, das erinnert stark an Steve Reich – und Minimal Music spielt hier eine große Rolle. Florent schmiegt sich mit seinen Songs an die innovative E-Musik an; dass er sich ihr vollständig ergibt, das sucht man dennoch vergeblich. Das Fundament bleibt ein moderner Europäischer Jazz, kreativ und teilimprovisiert.
Das hört man deutlich bei „Moulindjek“, das seine Verwandschaft im Piano zu Vince Guarraldi kann nicht verstecken kann und will; dabei von Drums und Kontrabass wunderbar gerahmt wird. Wenn Florent vom pizzing zum con arco-Spiel übergeht, entsteht ein erstaunlicher Effekt: Zwischen dröhnenden/dronigen Momenten und Folklore changierend, verdüstert sich der Song. Langsam fällt er in sich zusammen. Aber keine Sorge: Was sich alles ein wenig verkopft anhört, ist auch geschmacklich sehr sicher und gefällig.
So wie alles hier auf dieser riskanten Platte, die auf dem grandiosen finnischen Jazz-Label We Jazz erschienen ist und sowohl digital als auch in CD- und Vinyl-Form erhältlich ist.
Text: Lars Fleischmann.
Der 70-jährige französische Komponist und Multiinstrumentalist Pierre Bastien kommt am 27. Januar mit seinen Maschinen ins King Georg.

Die 1980er markieren den endgültigen Durchbruch der Maschinen-Musik. Damals wurden Synthesizer, Drum-Machines und Sampler unweigerlich zu gleichberechtigten Tools im Repertoire der Musiker*innen – die Hip-Hop- und Electro-Sounds des Samplers Akai MPC waren genauso gültig wie jene einer Gitarre und die Grooveboxen von Roland (808 und 909), sowie der Bass-Synthesizer 303 sollten unmittelbar an der Techno-Revolution beteiligt sein.
Heute hat man sich an allerlei gewöhnt: Manchmal steht nicht mehr als bloß ein Laptop auf einer Bühne und wenn ein*e DJ eine Plattentasche statt USB-Sticks anschleppt, dann hat das mindestens Seltenheitswert.
Das kann man unstylisch oder unsexy finden, vielleicht sogar albern; andere wiederum sehen in der fortgesetzten Weiterentwicklung und Synthetisierung musikalischer Quellen die normale Progressivität menschlicher Kultur. Für Pierre Bastien, so scheint es zumindest, sind solcherlei Diskussionen sowieso nebensächlich. Der französische Komponist, Musiker und Bastler hat sich bereits im Jahr 1976 davon verabschiedet das eine (die reale Soundquelle) gegen das andere (das synthetisch-elektronisch-digitale Instrument) auszuspielen: Im Sommer des Jahres entstand seine erste Klangskulptur. Seitdem baut Bastien kontinuierlich an einem mechanischen Orchester aus Maschinen. In Anlehnung an den Schriftsteller Karel Čapek nennen wir solche Erfindungen Roboter – auch wenn keine der Bastien’schen Basteleien, aus den Einzelteilen der englischen Miniatur-Firma Meccano, den Eindruck eines C-3PO oder des Terminators erweckt.
Vielmehr sind viele seiner »Musiker«, wie er die Maschinen nennt, einfache Kreationen aus wenigen Bauteilen und zwei, drei Motoren. Sie sind trotzdem mehr als bloß zweckdienlich: Ihre Klangerzeugung – Kämme werden geschrubbt, Hämmer geklopft – ist zirkular. Das Ergebnis: Ein Orchester voller Wiederholungen; man könnte auch Loops sagen. Die Schleifen nutzt Bastien dann um Kurzkompositionen und Vignetten aufzubauen. Kleinere Übungen, hochinteressante Einheiten von wenigen Minuten Länge.
Während er sein »Mecanium« genanntes Orchester aufbaut, spielt er als Multi-Instrumentalist auch in herkömmlichen Bands. Er steigt beim Bel Canto Orchestra des französisch-katalanischen Komponisten Pascal Comelade (selbst eine Legende der Post-Strukturalisten und Avantgarde-Jazzer) ein; ganz ohne seine Maschinchen, dafür mit seiner Piccolo-Trompete oder auch mal am Kontrabass.
Auf der Aufnahme zu »Moments Du Bruits Pendant Le Naufrage« spielt er wiederum ein Plastik-Saxofon und das Cello. Im Bandgefüge des ebenso experimentell wirkenden Comelade kann sich Bastien austoben und -probieren. Vorher noch gründet er mit Bernard Pruvost die ebenso legendäre Band Nu Creative Methods.
Der Durchbruch in europäischen Avantgarde-Kreisen folgt derweil erst 1988, als sein erstes Solo-Album – wenn man hinsichtlich seiner Roboter überhaupt von solo reden kann – »Mecanium« erscheint. Zu dieser Zeit entwickelt er seine Live-Spielhaltung, die auch heute den »Ton angibt«: Hinter einem Tisch, der vollgepackt ist mit allerlei Maschinen, sitzt Bastien und spielt Trompete. Auch hier beherrschen Kurzformate die Szenerie, wenngleich unter Fans gerade seine längeren Stücke besonders beliebt sind. Im Zusammenspiel zwischen sukzessiven Loops und freiem Trompetenspiel entstehen Trance- und Traum-hafte Sequenzen voller schlichter Tiefe.
Die einzige wirkliche Gefahr für die Musik des Franzosen, der mit seinen 70 Jahren immer noch eine stets neue Hörer*innenschaft begeistert, besteht in steigenden Stromkosten.
In Deutschland wird Pierre Bastien besonders bekannt als er 1996 und 1997 mit Jaki Liebezeit – dem legendären Drummer der Kölner Krautrock-Band CAN – in die Manege steigt. »Ich habe Jaki vor besondere Aufgaben gestellt, als ich zwar vorschlug, dass wir auf Basis eines 12-Takt-Loops improvisieren sollten, meine Maschinen aber 12-1/2-Takte brauchten«, erzählte er vor Jahren der englischen Zeitung The Guardian.
Das Eigenleben der Maschinen ist gleichsam ihre größte Stärke: Unbeeindruckt von Software-Updates oder manueller Bedingung spielen diese Maschinen auch dann noch, wenn Computer-Viren die Welt längst lahmgelegt haben sollten. Die einzige wirkliche Gefahr für die Musik des Franzosen, der mit seinen 70 Jahren immer noch eine stets neue Hörer*innenschaft begeistert, besteht in steigenden Stromkosten. Die könnten der Musik den sprichwörtlichen Stecker ziehen … obgleich Bastien dann trotzdem immer noch etliche Instrumente spielen kann und genug Erfinder- und Bastlergeist hat, um ad hoc zu improvisieren.
Gleichsam soll nicht der Eindruck Bastien hätte sich seit den Achtziger und Neunziger Jahren nicht weiterentwickelt. So produktiv wie noch nie, veröffentlichte und erschien er auf ingesamt elf Platten in den letzten fünf Jahren. Namhafte Labels wie Other People (des hippen New Yorker Produzenten Nicolas Jaar) und Discrepant releasten seine Stücke; ebenso das Label des Brüsseler Kulturortes Les Ateliers Claus, Les Albums Claus.
Bastiens Karriere läuft und läuft und läuft; fast so, als wäre er selbst … eine Maschine.
Text: Lars Fleischmann
Der Bildende Künstler und Musiker Camillo Grewe spielt am 13. Januar in der King Georg Klubbar sein erstes Solo-Konzert.

Camillo Grewe treffen wir an einem herbstlichen Nachmittag im Winter zu einem Tee, da er dieser Tage ein Konzert im King Georg spielt. Betont sei: Es ist sogar sein allererstes Solo-Konzert. Bis dato kennt man den 1988 geborenen Grewe vor allem als Bildenden Künstler, der bereits Erfolge – wie zum Beispiel das Friedrich-Vordemberge-Stipendium der Stadt Köln – verzeichnen konnte.
Nebenher gab es derweil immer auch musikalischen Output. Diese zwei »kreativen Kanäle« sind seit der Kindheit angelegt. »Ich habe seitdem ich sieben oder acht Jahre alt war Klavierunterricht gehabt«, resümiert er heute, »und gleichzeitig auch immer gemalt und gezeichnet. Es gab immer beides.«
Später dann, zu Oberstufenzeiten, entschied er sich einstweilen für die Karriere als Künstler: »Ich nahm damals Abstand vom Klavier.«
Besondere Klänge
KlängeDas Handtuch wollte Grewe dennoch nicht werfen. Eine CD des Jazz- und Rockgitarristen John McLaughlin, die er seinem Bruder geschenkt hatte, wies ihm einen neuen Weg. Schon länger hatte ihm sein Klavierlehrer geraten, sich doch den Percussions und dem Schlagzeug zu widmen – McLaughlins Ausflüge in die klassische indische Musik war nun ein willkommener Anlass. »Das war eine Platte mit Zakir Hussain – einem bekannten Tabla-Spieler«. Das Projekt hieß Shakti, und Grewe war vom Sound der traditionellen, nordindischen Trommel angetan. »Ich fand diese Musik superspannend. Ich habe dann gesehen, dass es auch einen Tabla-Lehrer in Münster gab, wo ich damals gewohnt habe. Ich habe fünf Jahre Unterricht gehabt«, erzählt er und erklärt als nächstes die besondere Spielweise: »Die einzelnen Schläge werden lautbildlich gesprochen – eine eigene Erfahrung.« Diese Bols, wie sie heißen, werden entweder beim Spielen oder statt des Spielens auf der Tabla angestimmt: tun na dha ti dha ge dhin na
Auch heute interessiert er sich für Instrumente, die einen eigenen Klang besitzen und meist übersehen werden. Gerade auch sogenannte »Kinderinstrumente« (wie Melodica, Blockflöte oder Glockenspiel) tauchen in seiner Musik immer wieder auf. Das gilt auch für das Konzert im King Georg.
Doch weiter will er sich nicht in die Karten blicken lassen: »Die Leute sollen unvoreingenommen das Konzert besuchen. So viel sei nur gesagt: Es wird vielleicht klassischer beginnen und dann einen Transformationsprozess durchlaufen.«
Konzerte sind für Camillo Grewe keine Neuheit. Gerade mit seiner Band Fragil tritt er seit 2011 regelmäßig live auf. Damals habe man sich auf Anraten des Düsseldorfer Künstlers Alex Wissel zur Band zusammengetan. Wissel, der heute sehr gefragt ist und unter anderem durch seine Arbeiten mit dem Düsseldorfer Regisseur Jan Bonny auch einem Mainstream-Publikum bekannt wurde, hatte damals seine »Single-Club«-Reihe ins Leben gerufen: 24 Stunden währende Happenings zwischen Performance, DJ-Sets, Konzerten von Laien, Amateuren und Profis – sowie jede Menge Wahnsinn. Fragil wurde zur »Hausband« dieses ausladenden Spektakels.
So viel man damals spielte – fast monatlich – , so sehr machte man sich auf Platte rar. Das gilt bis heute. Gerade mal drei Platten sind in über zehn Jahren entstanden. Das bisher letzte Album »Hallo Ich« ist produktionstechnisch am ambitioniertesten, professionellsten und bietet einen Post-Kraut-Indie-Pop-Sound entsprechender Güte. Genauso eigen, dafür eher Lo-Fi sind die Stücke des letzten Albums „Motivation“. Allen Songs gemein: Man kann und darf sie gerne als „artschooly“ im besten Sinne bezeichnen. Kein Zufall eingedenk der Tatsache, dass alle Beteiligten tatsächlich an einer Kunstakademie studiert haben.
Eine eigene Notation
Auch beim Konzert könnten Fragil-Songs gespielt werden – nur diesmal alleine: »Es war spannend, das erste Mal solo an den Stücken zu arbeiten. Die Arbeit in einer Band ist manchmal nervenaufreibend. Es dauert natürlich länger, bis ein Song entsteht und fertig ist. Diesmal hat es sich eher angefühlt wie die Arbeit im Atelier als Künstler.«
Fragil sei für ihn eine Sache der Attitude: »Ich spiele da ein paar Akkorde und dazu zwei, drei Töne. Alles minimal, was die Komposition angeht. Ich liebe es, klare Melodien aus wenigen Tönen zu behaupten.« Dieser Gitarren-Indie-Sound wird von der Band selbst liebevoll als »Proseccopunk« bezeichnet. Irgendwie widerständig, leicht krawallig, in der Lage, mit wenigen Akkorden nachhaltig Eindruck zu machen, aber eben keine Bande von »Schreihälsen«.
Darüber hinaus gibt es vielfältige musikalische Ausflüge: Für die Oper »Cupid and the animals« von Agnes Scherer, die von der New Yorker Galerie TRAMPS in Auftrag gegeben wurde, hat Grewe die Musik komponiert. »Klavier, 2 Blockflöten, 3 Sänger, 2 Flamencotänzer und ein Dudelsack – dafür habe ich mir eine eigene Notation ausgedacht, da ich selber nicht besonders gut beziehungsweise flink im Notieren bin. Die sehr bildhafte, zeichnerische Notation habe ich den Musikern (in dem Fall vor allem den Blockflötistinnen) erklärt.« Die Oper wurde in Folge sowohl im BAM (Brooklyn Academy of Music) in New York, als auch im Museum Ludwig in Köln aufgeführt.
Ebenso ambitioniert war das musikalische Projekt »Konzert für 13 Vögel«, das Grewe auf Einladung der Gruppe Hall & Rauch mitkomponierte. Heute heißt die Komposition »Psychoreo«. An der historischen Grenze zur Corona-Pandemie entstanden, wurde das Konzert erstmals in der Philharmonie im Jahr 2021 aufgeführt: »Als das Konzert Corona-bedingt um ein Jahr verschoben wurde, entschieden wir das Ensemble um ein Streicherquartett zu erweitern. Daraufhin schrieb ich über ein 3/4-Jahr gemeinsam mit Malte Priess (Gitarrist der Band) die Streichersätze für die Songs.«
Im King Georg sollen, das verrät Grewe zum Ende dann doch, all diese verschiedenen Projekte und Bands und Songs kumulieren: »Ich habe für das Konzert alte und neue Songs zusammengebracht. Für Leute, die meine Musik kennen, wird es ungewohnt düster und persönlich.«
Text: Lars Fleischmann
In einer Stadt voller grandioser Pianist*innen konnte sich der gebürtige Saarländer Felix Hauptmann eine herausragende Rolle erspielen. Wir sprachen mit ihm über seine Band Percussion.
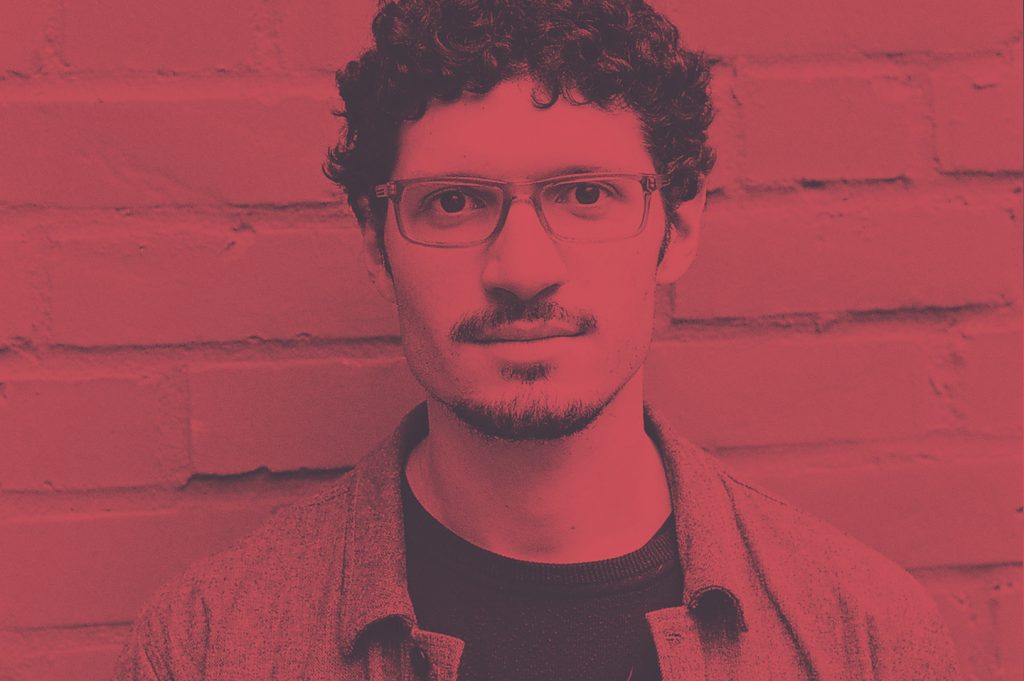
Der Preisträger des Horst und Gretl Will-Stipendiums für Improvisierte Musik der Stadt Köln 2022 ist ein hoch-aktiver Part der hiesigen Szene – als Komponist, Musiker, Dozent und Veranstalter. In der Jury-Begründung heißt es dazu: »Als Pianist ist er ein hellhöriger Sideman, als Solist und Komponist arbeitet er nachdrücklich und kreativ an der Findung und Erfindung eigener Wege. Seine kompositorische Handschrift ist geprägt von einer erstaunlichen Vertrautheit mit Kompositionsweisen zeitgenössische E-Musik, […]“ Diese Vielseitigkeit zeichnet Hauptmann seit mehreren Jahren – er kam bereits 2012 nach Köln zum Studium an die Hochschule für Musik und Tanz – aus und spiegelt sich in seiner eigenen Musik wider, die nicht bloß nach Diktaten oder Maximen funktioniert, sondern sich in einem steten Wandlungsprozess befindet.
Im Dezember letzten Jahres spielte er mit seiner Band Percussion – mit Roger Kintopf am Kontrabass und Leif Berger am Schlagzeug – im King Georg. Das Video des Auftritts könnt ihr euch hier anschauen.
Deine professionelle Karriere begann sehr früh. Deine erste Duftmarke hast du mit dem HNK Trio gesetzt, da warst du noch lange nicht volljährig. Wie kam es dazu?
Über meinen damaligen (Jazz-)Klavierlehrer aus dem Saarland, Christoph (»Sunny«, Anm. d. Aut.) Mudrich, der sehr gut vernetzt war, kam es zu dieser Verbindung. Er hat sehr viele Workshops gegeben und wahnsinnig viel unterrichtet, kannte deswegen sehr viele (Hobby-)Musiker*innen. Als er merkt, dass das bei mir in eine gewisse, professionellere Richtung gehen könnte, hat er sich im Saarland umgeschaut nach Leuten, mit denen ich eine Band gründen könnte. Er fand dann Conrad (Noll) und Fabian (Künzer). Als wir dann merkten, dass wir nicht nur Standards spielen wollten, sondern auch selbst etwas schreiben wollten, fing die Band an zu arbeiten. Da war ich 16 als es ernster wurde.
2011 habt ihr dann den Studiopreis des Deutschlandfunks gewonnen. Fühlt man sich da wie ein Wunderkind?
Nee, wie ein Wunderkind habe ich mich nie gefühlt. Dafür war das auch viel zu weird. Der Wettbewerb war in Dortmund und das war der erste Wettbewerb, den ich gespielt habe. Ich hasse Vorspiele und Wettbewerbe – heute zumindest. Aber damals waren wir da, weil es auch keinen anderen Bewerber aus dem Saarland gab. Es hieß »Entweder fahrt ihr hin oder keiner«. Als wir dann ankamen, ohne Vorausscheid oder ähnliches, und hörten auf welchem Niveau dort gespielt wurde, war für uns klar: Da ist nichts zu holen. Einige andere Bands waren schon älter, waren teilweise schon im Studium. Wir haben uns dann sehr gefreut als wir tatsächlich gewonnen haben.
Aber das hat nicht dazu geführt, dass ich mich jetzt herausragend fand. Ich wurde immer sehr unterstützt, das ist super schön. Als Wunderkind habe ich mich dennoch nie gefühlt.

Dein Instrument, wenn wir es mal als Pianoforte nehmen, dann ist es vermutlich das weitverbreitetste oder bekannteste Instrument der Welt …
… der westlichen Welt …
… genau, der westlichen Welt sein den 1830ern. Aber da hat es mit der Gitarre die Musik am meisten beeinflusst. Deswegen ist es auch am besten untersucht, es wurde darauf alles gemacht, würde ich behaupten. Ist dieses inhärente Erbe grundlegend für deine Arbeit als Pianist?
Für mich bedeutet es eine gewisse Freiheit, dass schon alles gespielt wurde, schon jede Verbindung und jeder Akkord gespielt wurde. Ich kenne nicht so viel Musik, im Vergleich zu anderen Menschen, aber ich habe eine gewisse Sicherheit, dass wirklich alles schon einmal gespielt wurde. Das muss gar nicht groß das Licht der Welt erblickt haben oder hier, in Deutschland, angekommen sein – für mich ergibt sich daraus eben kein Auftrag etwas »Neues« zu schaffen. Darum geht es mir nicht. Wenn ich sowieso nicht das Rad neu erfinden muss, dann kann ich mich ja darauf konzentrieren, was ich spielen und erforschen will.
Anders ist es zum Beispiel, wenn auf der Bühne ein Instrument gespielt wird, das man hier nicht kennt: Da ist man erstmal mit dem Klang beschäftigt und vielleicht gar nicht so sehr mit dem, was gespielt wird.
Trotzdem versuchst du das Vokabular der Tasteninstrumente zu erweitern. Du widmest dich ja auch der Analog-Synthese. So steht es in der Begründung zum Kölner Horst-und-Gretl-Will-Stipendium…
Naja, partiell widme ich mich der Analog-Synthese. Ich finde es etwas amüsant, dass das dort als erstes angeführt wird. Es gibt nämlich Kolleg*innen, die sich dessen schon viel mehr angenommen haben. Ich würde für mich nicht behaupten, dass ich mich damit »beschäftige«.
Ich benutze den Synthesizer und habe erst letzte Woche auch eine Synthesizer-Session mit meiner Band Percussion gemacht, aber da erschöpft es sich schon.
Von daher gibt es ein Album von mir, »bloom (night)«, das habe ich zu Hause aufgenommen mit Synthesizern. Das ist aber auch nur auf Bandcamp und nie groß erschienen.
Der Groove ist wichtig
Ich frage mich, ob du gerade dabei bist gewisse Sackgassen in der am Klavier gespielten Jazz- und Improvisierten Musik (für dich) aufzulösen.
Diese Sackgassen liegen nicht am Instrument, sondern wenn an mir.
Und dennoch widmest du dich eindeutig mit deiner Band Percussion der Rhythmik, was ja das neue Forschungsfeld der Musik darstellt, nachdem in den letzten Jahren Harmonik auf die Spitze getrieben wurde und ausformuliert scheint.
Ja, voll. Das ist natürlich der Grundgedanke. Der Name Percussion ist da auch on the nose. Der ergab sich aus Stücken, die ich mal gemacht hatte und dann nur »Percussion 1« etc. nannte. Nachdem ich »Talk« rausgebracht hatte, war das ein schöner Moment. Ich war sehr zufrieden und konnte trotzdem sagen, dass ich diese Musik erstmal nicht mehr spielen mag.
Woraus ergab sich dieses Gefühl?
Wenn man in Köln Klavier studiert, dann muss man wirklich alles gecheckt haben. Das Niveau ist extrem hoch. Und gerade, was Harmonik angeht, gibt es einen subtilen Druck, den man verspürt, während des Studiums. Ich wollte aber dann irgendwann etwas anderes machen. Und die schnellste und interessanteste Alternative dazu war Rhythmus. Ich bin sowieso Fan: Wenn es nicht groovet, dann ist es eh auch Quatsch …
Und nach einem Gespräch mit Leif (Berger, Drummer bei Percussion) im Zug, wo wir über Köln und das Niveau in der Stadt gesprochen haben, war klar: Harmonie bleibt dann letztlich ein begrenztes Feld im Zwölfton-System. Und Rhythmus ist unbegrenzt. Leif meinte, dass er es komisch finde, wie wenig da der Fokus drauf sei. Das war der Auslöser, um bei der Rhythmik tiefer einzusteigen.
Was ist die Idee bei Percussion?
Im Prinzip beruht die Art zu spielen allein auf den Stücken. Wir haben an dem Donnerstag, als wir im King Georg gespielt haben, 11 oder 12 Stücke gespielt. Das meint man vielleicht gar nicht, aber wir spielen vornehmlich Stücke, auch wenn die frei klingen. Wir haben extrem viel Material. Es gibt improvisierte Passagen, aber der Großteil ist komponiert.
Das überrascht tatsächlich. Weil ihr drei in eurer Spielweise sehr frei wirkt…
Weil wir es auswendig gelernt haben. Das ist ein großer Punkt. Das Material zu lernen hat ewig gedauert, weil es so umfangreich ist. Das ist mit Abstand die Band, mit der ich am meisten geprobt habe. Wenn wir einen Gig spielen – abgesehen jetzt von Touren -, dann müssen wir uns vor jedem Konzert wieder treffen.
Das ist für mich der Kern dieses Projekts: Die Musik ist natürlich sehr kompliziert, aber die Komplexität ist kein Selbstzweck, sondern nur Vehikel für eine arbeitende Band. Ich wollte einen Grund haben, um viel zu proben.
Ich denke immer: Die Musik ist so weird und schwierig, dass man sich fühlt wie bei der ersten Garagenband, wenn man versucht Pop-Songs zu covern, obwohl man nicht wusste, wie das Keyboard angeht. Und dann schafft man sich das drauf. Und genau dieser Vibe ist für mich Percussion.
Das bedeutet aber auch viel reinstecken …
Ja, genau. Es gibt manchmal so Hochnäsigkeiten. Da sagt man eine Komposition sei »kacke«, wenn man nach einer Probe keine Lust hat, ein Stück zu spielen. Ich denke, dass man bei den Privilegien, die wir hier genießen, dann muss da auch etwas mehr hinter stecken. Ich kann Musik machen nicht mehr angehen nach dem Motto: »Ich kann eh alles spielen und etwas, was mir nicht gefällt, lasse ich halt.« Percussion ist das Gegenteil: Die Kompositionen müssen erarbeitet werden.
Ich habe mich immer weniger damit gut gefühlt, in einem Land wie Deutschland zu leben und für mich ist alles easy, ich habe keine existenziellen Sorgen, und mich dann hinzusetzen und zu zocken. Das ist doch nicht nachhaltig, wo soll das hinführen.
Ich stehe gar nicht mehr auf dieses »Man kommt wohin und dann spielt man was weg«. Ich komme da ja her, aber das ergibt für mich und die Band keinen Sinn mehr. Ich habe mich immer weniger damit gut gefühlt, in einem Land wie Deutschland zu leben und für mich ist alles easy, ich habe keine existenziellen Sorgen, und mich dann hinzusetzen und zu zocken. Das ist doch nicht nachhaltig, wo soll das hinführen.
Das ist sehr anti-genialistisch und anti-romantisch.
Ja, das ist doch gut. Ich bin total froh, dass die Bandmitglieder bei Percussion, aber auch die Musiker*innen in den anderen Konstellationen, in denen ich spiele und arbeite, das genauso sehen. Da wird wahnsinnig viel geprobt und gesprochen, reflektiert und gezweifelt.
Du bist Lehrbeauftragter in Wuppertal an der Bergischen Hochschule … Was bringst du deinen Student*innen bei?
Ich kann den Student*innen sowieso nicht viel »beibringen«. Auch wenn mein Lehrauftrag »Jazz-Piano« heißt, lehre ich im Studiengang fürs Lehramt. Ich unterrichte also keine angehenden Berufsmusiker*innen, sondern jene, die später an den Schulen selbst unterrichten wollen. In den wenigsten Fällen geht es um Jazz-Klavier spielen. Es geht eher um konkrete Sachen: Wie kann ich einen Song arrangieren? Wie begleite ich Schüler*innen, wenn die auch mal etwas anderes probieren wollen als es der Lehrplan vorgibt? Es geht mir um das Vermitteln einer grundsätzlichen Flexibilität. Ich sehe mich eher als jemand, der Hilfestellungen gibt.
Nimmst du denn etwas mit für deine eigene Musik und Kompositionen?
Bisher nicht. Das liegt daran, dass ich schon sehr lange an meiner Musik arbeite und diese weit weg davon ist, was die Student*innen jetzt selbst interessiert. Mir nützt aber dennoch, dass ich schon so viel über Musik und meine Musik – was immer das im Detail heißen soll – nachgedacht habe. Was schon vorkommt: Ich höre Songs, die ich nicht kannte, aber cool finde. Das nehme ich mit. Und ich sehe und höre, was die noch jüngeren Menschen interessiert, mit welchen Problemen sind, die im Fach und generell konfrontiert … das sind zukünftige Lehrer*innen und ich bekomme einen Einblick, wie der Studiengang konzipiert ist und was demnächst gelehrt werden soll. Das versuche ich mitzunehmen …
Interview: Lars Fleischmann.