
Eine Fotografie: Ein Gewerbekomplex, Blech auf Stahlskeletten. Von unten nach oben sieht man einen Unterstand; eine Halle, die ein U formt; eine Gangway; ein Lüftungsrohr vermutlich; ein weiteres, diesmal in Blau; links postmodern-brutalistische Beleuchtungs- und Belüftungslöcher; wieder eine Gangway und ein Dach … Die Fotos des belgischen Fotografen Filip Dujardin sind bisweilen architektonische Verwirrspiele gegen die das Centre Pompidou in Paris wie ein Einfamilienhaus wirkt. Mithilfe digitaler Technik baut Dujardin in seinen andauernden Serien »Fictions« und »Impossible Architectures« solche, durchaus an M.C. Escher erinnernden, Gebäude aus Versatzstücken alter und neuer Industrie- und Gewerbebauwerke. Es entstehen Vexierbilder: Ist das nun real und möglich; oder doch nur eine surrealistisch-verstellte Fantasie und Fiktion?
Dujardins belgischer Landsmann Joachim Florent nahm sich in den letzten Jahren diese Fotografien immer wieder zum Anlass – vielleicht sogar zum Beispiel – um kleinere, geometrische Piano-Figuren am Klavier zu komponieren. Florent ist nicht nur ein Europa-bekannter Kontrabassist, sondern auch Physiker, was ihn in das französische Nantes verschlagen hat. Er sagt: »Ich bin zwar vergleichbar schlecht am Klavier, aber ich sitze trotzdem jeden Tag da und komponiere.« Bei diesen Übungen entstand das Material, das sich heute auf »Designers«, dem Debütwerk des gleichnamigen Trios, wiederfindet.
An Joachim Florents Seite stehen bei Designers der australische Drummer Will Guthrie, der ebenfalls in Nantes wohnt, und der finnische Pianist Aki Rissanen. Beide ließen sich auf das Experiment ein:
»Es war 2019 als ich anfing diese kleinen Studien zu produzieren, die eben eine geometrische Qualität besaßen«. Florent empfand eine einerseits mathematische, andererseits architektonische Songstruktur als interessante Herausforderung.
Hört man in »Engrenages«, dem Nabelstück des Albums, rein, fallen einem gleich die Pagoden-haften Piano-Arpeggios und -Ostinati auf, die in der Manier der Minimal Music hochsteigen und runterfallen, dabei markante Dach-Formationen (um in der Sprache der Architektur zu bleiben) bilden. Doch das ist nicht alles, was wir hören: Plötzlich befreit sich das Piano aus der Wiederholung und löst Akkorde hochdekorativ auf. Ganz klar: Das ist nicht geschrieben, sondern improvisiert.
Die Vermutung bewahrheitet sich, denn Florent hat nicht ganz ohne Hintergedanken Guthrie und Rissanen mit an Bord geholt, gelten beide doch als exzeptionelle Improvisateure.
Bevor man sich zu lange mit dem Spiel aus Komposition und Improvisation auseinandersetzen kann, geht es doch in fast halsbrecherischer Geschwindigkeit weiter; die Pause währt nur kurz. Ab jetzt spielen alle drei mit ordentlich Druck los. Nicht nur das Piano hetzt von Note zu Note, Guthrie trommelt fröhlich-wild und besenschwingend auf Hi-Hat und Snare rum, während der Kontrabass in Florents Händen Kapriolen schlägt.
Auch hier löst sich das Spektakel bald in »Luft« auf: Kontrabass und Schlagzeug teilen sich jetzt das Spotlight, gehen Hand in Hand in die Tiefe des Tracks. Mit ordentlich Swing auf der Führhand begleitet Will Guthrie formidable Kontrabass-Linien. Nach einem letzten Aufruhr endet das Lied erstmals … es könnte gleichwohl immer so weiter gehen.
Klar, das erinnert stark an Steve Reich – und Minimal Music spielt hier eine große Rolle. Florent schmiegt sich mit seinen Songs an die innovative E-Musik an; dass er sich ihr vollständig ergibt, das sucht man dennoch vergeblich. Das Fundament bleibt ein moderner Europäischer Jazz, kreativ und teilimprovisiert.
Das hört man deutlich bei „Moulindjek“, das seine Verwandschaft im Piano zu Vince Guarraldi kann nicht verstecken kann und will; dabei von Drums und Kontrabass wunderbar gerahmt wird. Wenn Florent vom pizzing zum con arco-Spiel übergeht, entsteht ein erstaunlicher Effekt: Zwischen dröhnenden/dronigen Momenten und Folklore changierend, verdüstert sich der Song. Langsam fällt er in sich zusammen. Aber keine Sorge: Was sich alles ein wenig verkopft anhört, ist auch geschmacklich sehr sicher und gefällig.
So wie alles hier auf dieser riskanten Platte, die auf dem grandiosen finnischen Jazz-Label We Jazz erschienen ist und sowohl digital als auch in CD- und Vinyl-Form erhältlich ist.
Text: Lars Fleischmann.

Der Auftritt der US-amerikanischen Trompeterin Jaimie Branch, die sich im Übrigen stets in Minuskeln schrieb (also jaimie branch), war eigenwillig, nicht gefällig, sondern fordernd und robust.
An Tattoos hat man sich natürlich auch schon in Jazz-Gefilden gewöhnt, ganz so punkig kommen aber die wenigsten daher. Man sah der 39jährigen an, dass sie es nicht immer »ganz leicht« hatte: Groß geworden ist sie in Brooklyn, harte Bedingungen. Studierte dann am New England Conservatory in Boston. Es zog sie nach Chicago. Dann zurück an die Ostküste, Baltimore. Noch so ein harter Ort. Vorher, nachher, zwischendrin lauerte der Sumpf. Wie viele Große der Zunft verfiel auch sie den Drogen; unter ihnen auch Heroin.
Branch hatte es nie leicht, das kann man hören
Branch hatte es nie leicht, was man auch hören kann, wenn man mag. Schmerz, Empörung, Groll, Wildheit: Das alles übersetzte die Trompeterin Branch, wie kaum jemand anderes, in eine hörbare (Mit-)Erfahrung. So furchtbar gut sie ihr Instrument im Griff hatte, so fürchterlich schrille Laute der Qual entlockt sie dem Blechhorn immer wieder. Ein glasklares, brutales Spiel, das Gänsehaut bereitet.
Umso erstaunlicher war ihre Vorliebe für das Trompetenspiel des Kölners Axel Dörner; bei ihm lieh sie sich die Möglichkeit Be-Bop und Free-Jazz, strikte Komposition und Freiheit, sogar Anarchie, zu verbinden. Da muss man sich auch in seiner Hörerfahrung ein wenig strecken; bei den anderen Vorbildern ist die Nähe offensichtlicher: Der Weltmusiker und Jazzer Don Cherry und natürlich der »Prince of Darkness« Miles Davis.
Gerade zu Davis, der ja selbst zeitlebens mit den Drogen zu kämpfen hatte, sind die Parallelen markant. Doch seit einiger Zeit war Branch wohl frei von Heroin.
»Ich hatte Angst, dass mit den Drogen auch meine Musik gehen könnte. Erst nach einiger Zeit erkannte ich aber, dass das Gegenteil der Fall war: Das Heroin hinderte mich an der Weiterentwicklung«, stellt sie erst vor wenigen Monaten fest. Und spielte lieber gegen die Dämonen an als ihnen noch einen Platz zu gewähren. Stattdessen war sie seit ihrem Debüt-Album im Jahr 2017 zu einem der gefragtesten Acts des Jazz gereift. Mit dem Nachfolger »Fly or Die II« stürmte sie dann auch die Feuilletons – die sich glücklicherweise immer seltener an ihrem Aussehen und ihrer direkten, bisweilen harten Art stoßen konnten.
Auch bei ihrem neuen Projekt Anteloper ging Branch andere Wege. Zusammen mit dem Drummer Jason Nazary verabschiedete sie sich in gepflegtem Maße vom Jazz, bloß um in später runderneuert und mit neuer Power wieder zurück zu bringen.

Im Namen des Projekts, einem Kofferwort, treffen die Antilope und der Eindringling (englisch: interloper) aufeinander. Branch und Nazary sahen sich zwar dauernd bereit zum Spurt, zur blitzartigen Flucht, hakenschlagend; zugleich aber auch als Eindringlinge, die keiner so richtig dabei haben mochte. Sie strampelten sich auf ihrem Album »Pink Dolphins« folglich ordentlich einen ab, wie man so sagt, und machten aus ihrer Schwäche eine Stärke. Der pinke Amazonas-Delfin gibt dementsprechend auch nicht ganz zufällig das Wappentier der ersten LP des Duos, ist dieser doch dafür bekannt, dass er sowohl im Süßwasser wie auch im Salzwasser des Atlantischen Ozeans sein Zuhause hat und auf Jagd geht. Andererseits ist er damit auch nirgendwo wirklich daheim … um es mal im Sinne des Duos zu deuten.
Dass man, trotz Draußenstehens, kein Anti-Jazz-Projekt startete, hört man an jeder Stelle. Beim Opener »Inia« werden vor allen Dingen Synthesizer-Klänge und -Noises eingesetzt, um dem ganzen Stück einen unruhigen Mantel zu bescheren. In der Mitte spielen Nazary und Branch dennoch, wie ihnen der (Jazz-)Schnabel gewachsen ist. In langgezogenen Phrasen akzentuiert sie hier das Rumpeln des Stücks. Sicher hat das etwas Gewaltiges, man könnte auch eine Punk-Attitüde attestieren. Allzu weit von den Jazz-Erneuerern aus London und Chicago ist das dennoch nicht.

Noch viel näher am Kern der Sache zeigen sich die beiden beim Titelstück wider Willen: »Delfin Rosado«. Hier treten dann noch zwei weitere Gestalten ins Rampenlicht, die bei dieser Platte als Geburtshelfer zugange waren: Jeff Parker und Chad Taylor. Letzterer steuert das afrikanische Lamellophon Mbira zu, das eine feine, immer markanter werdende pentatonische Konter-Melodie spielt.
Parker, selbst kein unbeschriebenes Blatt, wenn es um die Aufweichung von Genregrenzen geht (denken wir nur an seine Arbeit mit den Post-Rockern Tortoise), hingegen kommt gleich mit Gitarre, Bass und dem Synthesizer Korg MS-20 um die Ecke. Zusammen lassen es die vier dann auch Rappeln, der Track wirbelt sich immer höher. Seien wir ehrlich: Das ist verdammt nahe an dem, was wir von Miles Davis zu »Bitches Brew«-Zeiten kennen.
Miles Davis hätte Spaß an diesem Sound
Der alte Haudegen hätte sicher auch seinen Spaß am psychedelischen Cover gehabt: Die Delfine kommen vorsorglich direkt mit je drei Augenpaaren angeschwommen, die Sonne steht tief und orange am Firmament und sonst versinkt alles in einer ozeanischen Selbstentgrenzung.
Auf »Earthlings« hören wir die neue Branch dann zusätzlich als Vokalistin. Wütete sie noch auf ihrem umfeierten Album „Fly Or Die II“, schimpfte wie ein Rohrspatz über Trump und Konsorten, über die Us-amerikanische Einwanderungspolitik der letzten Jahrzehnte und und und, schlägt sie hier fast schon divenhafte Töne an: Nicht ganz Billie Holiday – auch da gäbe es Gemeinsamkeiten im Lebenslauf auszumachen -, aber doch vorzüglich. Bald schnappt sie sich doch wieder ihre Trompete, spielt aber nur eine Nebenrolle: Der vorzüglich angelegte, blecherne, metallische Beat Nazarys hält hier alles zusammen und treibt an, wie es sonst nur eine Maschine macht. Es entwickelt sich ein Schreiten … es geht voran.
»Pink Dolphins« ist ein faszinierendes Werk, eine LP, wie sie nur selten in einem Jahrzehnt vorkommt. Gleichzeitig eine Bestimmung des Fortschritt-Pegels im aktuellen Jazz, dann wiederum eine Außenseiterrolle einnehmend. Von innen nach außen und zurück, ja, im Zick-Zack durch die Zeit und diese Platte: So machten es wohl Anteloper wie Jaimie Branch und Jason Nazary.
Und wäre diese formidable Platte nicht Anlass genug gewesen von ihr und der großen Jaimie Branch zu berichten, muss dieser Text zum Ende leider sagen, dass diese Platte wohl auch das letzte bleibt, was wir von ihr hören werden. Branch ist am 22. August zuhause in Brooklyn mit 39 Jahren gestorben.
Text: Lars Fleischmann
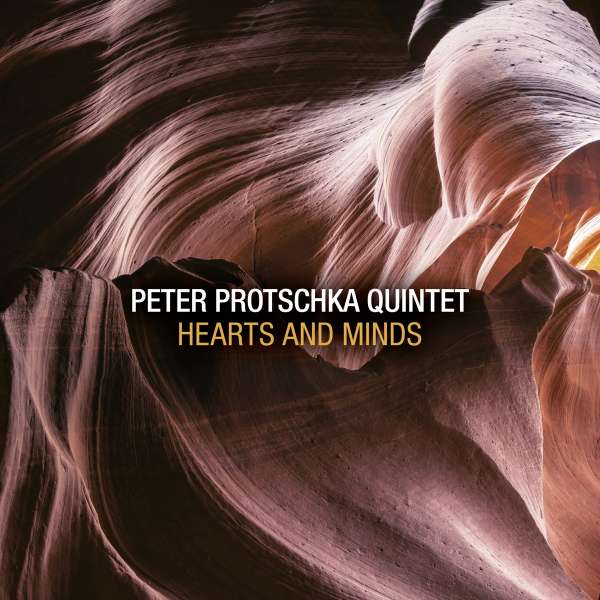
Das Quintett des Trompeters und Flügelhornisten Peter Protschka spielt in gleichbleibender Besetzung schon seit 10 Jahren zusammen. Auf dem vorliegenden Album ist zu hören, wie diese langjährige Zusammenarbeit zu einem luxuriösem Zustand der Vertrautheit geführt hat. Die Band ist »tight«. Die fünf müssen sich und den Zuhörern nichts mehr beweisen. Rick Margitzas »August in Paris« swingt genüsslich in mittlerem Tempo und wird von dem Tenorsaxofonisten und dem Flügelhornisten für gefühlvolle Solos genutzt. Pianist Martin Sasse soliert kurz und fesselnd über dem federnden Rhythmus von Bassist Martin Gjakonovski und Schlagzeuger Tobias Backhaus. Dann folgt eine melodische Gruppenimprovisation, bei der sich Protschka und Margitza elegant die Bälle zuwerfen. Die acht Stücke sind allesamt gelungene Eigenkompositionen von Protschka und Margitza, die dem Hörer ein Wohlfühlgefühl vermitteln, wie es sonst eher vielgehörte Standards tun. Dazu tragen auch die tontechnisch exzellente Aufnahme und Abmischung bei. Eindrucksvoll zeitgemäß wirkt das balladeske »Hymn For The Suffering« mit wohlgesetzten tiefen Tönen von Gjakonovski und berührenden Solos von Protschka am Flügelhorn und Sasse am Klavier. In Margitzas »E Jones« geht dann die Post ab mit Backhaus‘ swingender Beckenarbeit und Gjakonovskis mitreissendem Walking Bass. Sasse ist ganz in seinem Element, Protschka und Margitza brillieren mit inspirierten Solos. Das Album endet mit »Tom’s Groove« – just groovy!
Text: Hans-Bernd Kittlaus

Die Saxofonistin Karolina Strassmayer und Schlagzeuger Drori Mondlak haben unter dem Bandnamen Klaro! schon eine Reihe von Alben herausgebracht – dieses ist anders. Schon das erste Stück »Sing to Me of …«, ein Duo der beiden, stellt Mondlaks Perkussion viel stärker in den Vordergrund und ist musikalisch freier als die Vorgängeralben. Für »Mallets and Air« greift Karolina Strassmayer zur Flöte und spielt berückend schöne Töne über Mondlaks düsteren Trommeln und den Einwürfen von Pianist Rainer Böhm. In »Sticks and Flurries« hat Böhm mehr Raum, den er zu einem pointillistischen Solo über Mondlaks Besenarbeit nutzt, bevor Karolina Strassmayer ein lautmalerisch expressives Flötensolo beginnt. In »Brushes Dancing« solieren Strassmayer und Böhm melodisch über Mondlaks virtuos »tanzenden Besen«. In »Courage« greift Bassist Thomas Stabenow stärker ins Geschehen ein in einer längeren Trio-Passage mit Böhms fließenden Läufen, dann setzt Strassmayer zu einem immer intensiver werdenden Solo am Altsaxofon an, ihrem Erstinstrument. Stabenow leitet »aahhh!« mit einem Basssolo ein, alle vier machen dieses längste Stück dann zum stärksten Quartettstück des Albums. Mit »Freescapes« haben Drori Mondlak und Karolina Strassmayer eine neue Stufe ihres Musikerlebens erreicht. Sehr freie Improvisation, nicht im Sinne des Free Jazz, sondern inside, also innerhalb eines Harmoniegerüsts. Faszinierend – und ein Kandidat für die Bestenliste 2022!
Text: Hans-Bernd Kittlaus
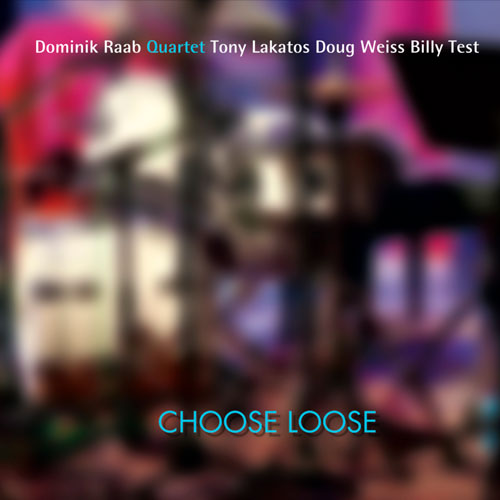
Der Schlagzeuger Dominik Raab, wiewohl erst Anfang 30, hat sich in den letzten Jahren in die erste Liga der deutschen Straight Ahead Drummer vorgearbeitet. Das vorliegende Album demonstriert zudem seine beachtlichen Fähigkeiten als Komponist mit acht Stücken aus seiner Feder. Der Titelsong besticht mit seiner warmen einnehmenden Melodie, die von Tony Lakatos auf dem Tenorsaxofon intoniert wird, bevor Pianist Billy Test das Stück interpretiert. Lakatos soliert immer intensiver, dann setzt Bassist Doug Weiss zu einem ruhigeren, aber ausdrucksstarken Solo an. Für »Cringe Worm« greift Lakatos zum Sopransaxofon und soliert Coltrane-esk über dem treibenden Rhythmus von Raabs Becken. Die Melodie erinnert wohl nicht ganz zufällig an Frank Loessers »Inchworm«. Die Ballade »Kind Mind« erfährt eine höchst gefühlvolle Interpretation mit einleitendem Solo von Test, ruhigem Spiel von Lakatos und melodischer Improvisation von Weiss über Raabs zurückhaltendem Rhythmus. In »Boss Gloss« und »Pneu à Pneu« geht es dann wieder voll swingend zur Sache. Dieses Album macht von Anfang bis Ende Spaß – zum Wohlfühlen auf hohem musikalischen Niveau.
Text: Hans-Bernd Kittlaus

Pete Malinverni – der Name wird den meisten Jazz-Fans kein Begriff sein. Dabei ist der Pianist, Komponist, Lehrer und musikalische Leiter schon seit 40 Jahren anerkanntes Mitglied der New Yorker Jazz-Szene. Sein Klavierspiel steht in der Tradition von Hank Jones und Tommy Flanagan, also feinstes Gespür für Harmonik und Struktur sowie kreative Improvisation, die sich nie zu weit von der Idee des Komponisten entfernt, basierend auf solider Handwerkskunst. All das demonstriert Malinverni hier im Trio mit Bassist Ugonna Okegwo und Schlagzeug-Meister Jeff Hamilton. Das Programm besteht aus Kompositionen von Maestro Leonard Bernstein, der zwar primär der klassischen Musik zugerechnet wird, aber auch beachtliche Werke für den Broadway geschaffen hat. Malinverni spielt Stücke aus »West Side Story«, »On the Town« und »Wonderful Town«. Bekannten Ohrwürmern wie »Somewhere«, »Cool«, »I Feel Pretty« und »Some Other Time« gewinnt das Trio neue Facetten ab, weniger bekannte Stücke wie »Simple Song« und »It’s Love« bieten neue Einsichten in Bernsteins Oeuvre. Am Ende steht Malinvernis Eigenkomposition »A Night On The Town« als Tribute an Bernstein, den Malinverni noch persönlich kennenlernte, wie er in den Liner Notes erzählt. Dieses Album revolutioniert nicht den Jazz, aber wird allen Freunden des klassischen Jazz-Klaviertrios viel Freude machen.
Text: Hans-Bernd Kittlaus
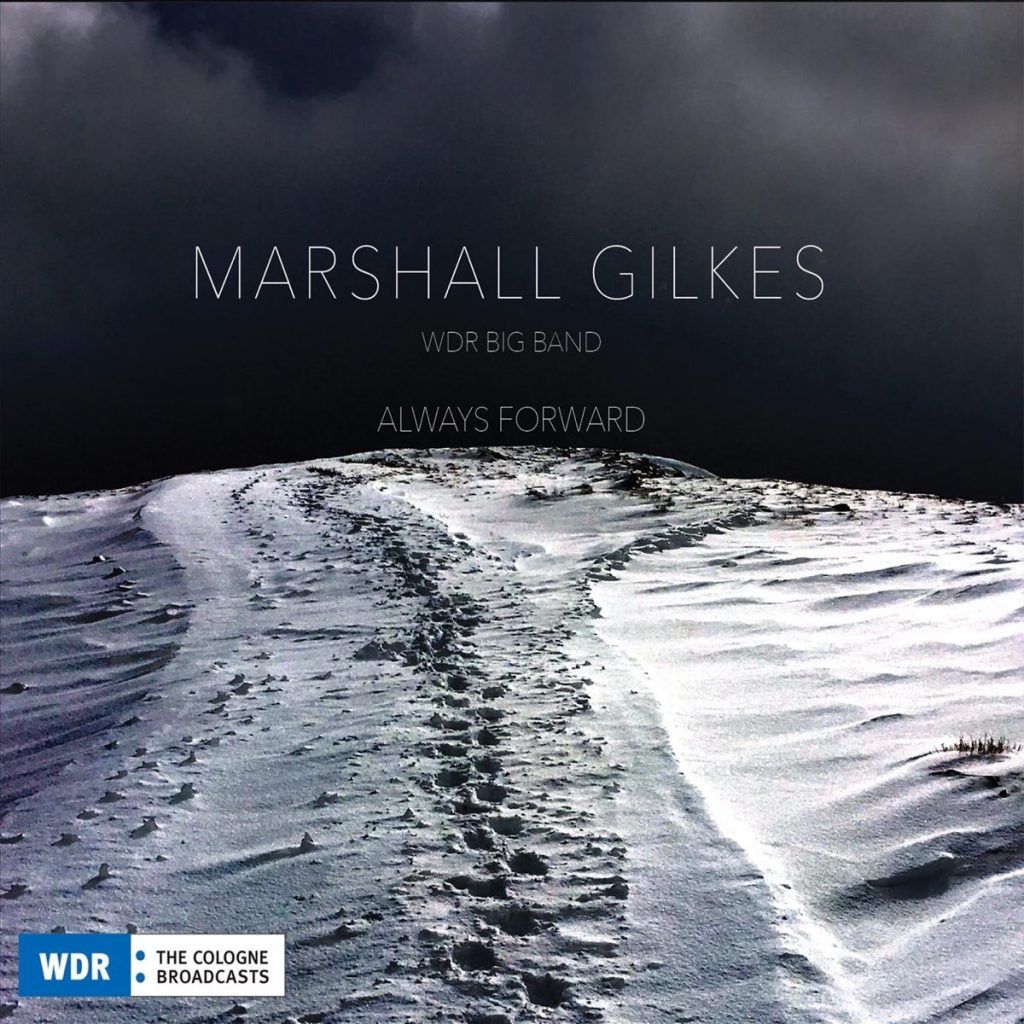
Posaunist, Komponist und Arrangeur Marshall Gilkes ging nach vier Jahren als Mitglied der WDR Big Band Ende 2013 zurück nach New York. 2015 erschien dann sein Album »Köln« in Zusammenarbeit mit der WDR Big Band, das für einen Grammy nominiert wurde (siehe JP04/15). War »Köln« schon eine höchst überzeugendes Big Band-Album, zeigt »Always Forward« mit Aufnahmen vom September 2017 eine deutliche Weiterentwicklung. Gilkes‘ Kompositionen zeichnen sich durch melodischen Gehalt aus. Seine Arrangements bestechen mit geschickter Verbindung von satten Bläsersätzen und Solo-Stimmen, schöpfen den Reichtum an Klangfarben der WDR Big Band voll aus und lassen die Solisten der WDR Big Band leuchten, etwa die Altsaxofonisten Johan Hörlén in »Easy to Love« und Karolina Strassmayer in »Switchback«. Auch John Goldsby brilliert mit wohlgesetzten Bass-Tönen hinter Andy Haderers Flügelhorn in »Portrait of Jennie«. Gilkes selbst gibt sich erfreulicherweise etwas mehr Raum als Solist als auf »Köln«. Es gibt wahrlich nicht viele Posaunisten weltweit, die ein Tour de Force-Solo spielen können wie Gilkes im ersten Stück »Puddle Jumping«. Sein wunderbarer Ton mit der exakt richtigen Mischung von Weichheit und Attacke über den gesamten Frequenzbereich des Instruments, seine atemberaubende Technik im Dienste der Musik, seine Musikalität vom Schwelgen in der Melodie bis zum Einsatz der Posaune als Rhythmusinstrument kommen optimal zum Ausdruck.
Text: Hans-Bernd Kittlaus

Selbst Eingeweihten sagt der Name Jothan Callins vergleichsweise wenig. Callins hat als Side- und Bandman in verschiedenen Konstellationen gespielt, landete auch bei B.B. King und Stevie Wonder, dennoch sind seine diskografischen Beiträge spärlich gesät. Einen großen Teil seiner Musikkarriere verbrachte er als Dozent und Lehrer – und vier bedeutende Jahre auch beim Sun Ra im Arkestra. Es sollten die letzten vier Jahre des charismatischen Jazz-Innovators und »Alien auf Durchreise« Sun Ra sein. Callins und ihn verband, dass sie beide in Birmingham, Alabama geboren wurden. Sun Ra 1914, Callins 28 Jahre später. Das berüchtigte Zentrum der Segregation und rassistischen Unterdrückung der Schwarzen Bevölkerung brachte die Musiker hervor – natürlich sind sie jeweils Autodidakten gewesen.
Vor seiner Zeit im Arkestra (ab 1989) war Callins natürlich dennoch auch abseits der Musikschule unterwegs. Das einzige Artefakt dieser Zeit ist diese Platte, die nun vom portugiesischen Label »Mad About« nach 50 Jahren wiederveröffentlicht wird. »Winds Of Change« und hat weder mit den Scorpions noch mit dem Mauerfall zu tun. Nein, die Winde, die hier den Wandel bringen, sind spirituelle, musikalische, frei blasende und pustende.
Es ist die Aufnahme einer Session in New York, 1972. Neben Callins, der hier als Trompeter auftritt (er spielte in seiner Karriere auch noch Kontrabass), bilden Roland Duval (Percussion), Norman Connors (Drums), Joseph Bonner (Piano, Tambourin) die Besetzung. Der bekannteste Name ist Cecil McBee. Den Kontrabassist kennt man vor allen Dingen als Sideman für Wayne Shorter, Yusef Lateef, Alice Coltrane und unzählige weitere.
Es ist gewissermaßen eine bande à part, eine Gruppe außerhalb des Scheinwerferlichts, fernab der großen Hall of Fame. Dennoch: »Winds Of Change« ist eine hervorragende Spiritual Jazz-Platte, nicht überbordend, sondern der Sache verpflichtet. Gelegentlich taucht man in Träumereien ab, meist aber spielt man einen vertrauten Strata-East-Sound. Für seine Zeit fast schon konservativ erscheint der Opener »Prayer For Love and Peace«, das Chaos setzt erst im Titelstück ein. »Sons And Daughters Of The Sun« ist supergeschmeidig; trotz ordentlicher Dynamik in der Rhythmus-Sektion. Auch der Closer »Triumph: Invitation« schiebt kräftig an. Es ist immer wieder schön anzuhören, wie hier die verschiedenen Instrumente auseinander laufen und dann wieder zusammenkommen. Was soll man sagen: Die B-Mannschaft versteht ihr Handwerk. So ist diese Reissue vor allen Dingen eine Aufforderung an uns Hörer*innen, auch mal abseits der großen Prachtboulevards zu suchen und Nischen auszutesten. Es warten noch unzählige Werke à la »Winds Of Change”, die wiederentdeckt wollen.
Text: Lars Fleischmann

Schlagzeuger und Berklee-Professor Ralph Peterson bleibt kontinuierlich produktiv mit verschiedenen Bands und Album-Veröffentlichungen auf seinem Onyx Label. Er kann auf eine beachtliche Karriere als Sideman zurückblicken, unter anderem als zweiter Drummer für Art Blakey, mit David Murray und einem Who Is Who des Jazz der 1980er und 1990er Jahre, aber auch immer wieder mit eigenen Bands. Mit Aggregate Prime hatte er schon 2016 das beachtliche Studio-Album »Dream Deferred« vorgelegt, es folgt mit »Inward Venture« eine Live-Aufnahme des leicht umbesetzten Quintetts, aufgenommen im März 2018. Gemeinsam mit Bass-Altmeister Curtis Lundy sorgt Peterson für energiegeladenen pulsierenden Rhythmus, über dem Saxofonist Gary Thomas ausdrucksstarke Solos bläst, etwa in »I Hear A Rhapsody«. Den meisten Solo-Platz bekommt Gitarrist Mark Whitfield, den er oft mit fliegenden Läufen nutzt wie in Petersons Eigenkomposition »Soweto 6«. Dieses Stück enthält ein inspiriertes Solo vom jungen Pianisten (und Sohn) Davis Whitfield, der auch in Andrew Hills »Venture Inward« brilliert. Das Album endet mit Lenny Whites »L’s Bop« in rasend schnellem Tempo und mit Mark Whitfields eindrucksvollstem Solo.
Text: Hans-Bernd Kittlaus

Trompeter Matthias Schriefl und seine Band Shreefpunk erhielten vor gut zehn Jahren erste große Aufmerksamkeit in der deutschen Jazz Szene mit ihrem wilden Mix aus Jazz, Rock und Punk in der exzellenten Besetzung mit Gitarrist Johannes Behr, Bassist Robert Landfermann und Schlagzeuger Jens Düppe. Mit diesem Album ließ Schriefl die Band 2018 wieder aufleben und mischt auf virtuose Weise Streicherinnen und Sängerinnen dazu. In den zwölf Eigenkompositionen kommt die ganze Bandbreite Schriefls zum Ausdruck, sein ins Absurde gehender Humor in der Tradition Karl Valentins, seine Verwurzelung in alpenländischer Volksmusik wie auch seine herausragenden Fähigkeiten als Trompeter und Arrangeur. »Birthday Party in Athens« startet mit schönem Bass-Solo von Landfermann, gleich zwei Schlagzeuger, Düppe und Jonas Burgwinkel, sorgen für heißen sehr variablen Rhythmus, über dem Schriefl zu heftiger Streicherbegleitung soliert und kurzzeitig alpenländische Elemente einbringt. Dann lässt Behr mittels seiner E-Gitarre den Rock ausbrechen und die Band steigert sich zu einem furiosen Klangfinale, bevor das Stück ruhig ausklingt. In »Südtiroler Rundungen« wechselt sich lieblicher Volksmusikgesang des Damentrios Netnakisum mit aggressiver E-Gitarre Behrs ab. Ein Highlight ist »Steuererklärung«, ein satirisches Loblied auf die liebste Beschäftigung der Deutschen mit dem Zeug zum Radiohit. Das Album ist typisch Schriefl, von allem etwas zuviel, und gerade dadurch genialisch.
Text: Hans-Bernd Kittlaus