Eine Woche Live-Programm Anfang September, damit ihr euch von der Sommerpause ohne Konzerte erholen könnt. Mit Tom Gaebel und seinem Trio, Sendecky & Spiegel, dem Melting Pot Sommerfest u.v.a.

Zugegeben, eine richtige Sommerpause legen wir ja eigentlich nie ein. Und das gilt auch in diesem Jahr. Die Zeit ohne King-Georg Live-Konzerte im Juli und August überbrücken wir mit unseren King Georg On Tour-Veranstaltungen sowie vielen Jazz Bar Specials. Abende, die musikalisch unter einem bestimmten Motto stehen, und die dazu einladen, Jazz an der Theke unseres atmosphärischen Clubs auch mal aus der Konserve zu genießen. Bei eingeschalteter Klimaanlage versteht sich. Nur vom 15. bis 21. Juli ist der Laden wegen kleinerer Umbauarbeiten komplett dicht.
Live-Jazz und Artverwandtes
Klar ist aber auch, dass wir unserem Anspruch »Jazz fürs Publikum« in der Jazzstadt Köln zu bieten, in der Regel mit Konzerten gerecht werden wollen. Das King Georg ist ein Ort für Live-Jazz und Artverwandtes. Also wollen wir das Ende der kurzen Durststrecke auch ordentlich zelebrieren.
A Swinging Affair
Los geht’s am Montag, den 2. September mit Tom Gaebel und seinem Trio. Der Titel des Abends, »A Swinging Affair! The American Songbook And Beyond« verspricht eine Session ganz im Sinne aller Fans von Straight Ahead-Jazz. Eine zeitgemäße und virtuose Reminiszenz an die Klassiker.
Jazz ohne Pause
Die ganze Woche über erwartet euch täglich ein vielfältiges Programm, das wir mit der Swing & Lindy Night am Samstag beschließen. Allerdings nur symbolisch. Denn am folgenden Montag, den 9. September geht es bei uns natürlich direkt weiter. Mit Peter Protschka/ Adrian Mears feat. The Carl Winther Trio. Die nächste Pause gibt es frühestens im kommenden Sommer. Wenn überhaupt …
Hier das komplette Programm der Re:Opening-Week
Montag, 2. September
Tom Gaebel & His Trio »A Swinging Affair! The American Songbook And Beyond«
Dienstag, 3. September
Mittwoch, 4. September
Donnerstag, 5. September
Freitag, 6. September
Samstag, 7. September
Swing & Lindy Night & Matti Nieves, C:Mone, Hermes Villena
Die Cologne Jazz Supporters e.V. (CJS) haben zum fünften Mal ihren Kompositionswettbewerb für Jazz-Musiker und Musikerinnen aus NRW durchgeführt. Es gab 43 Einreichungen. Hier sind die Gewinner.

Der erste Platz im diesjährigen Kompositionswettbewerbs der Cologne Jazz Supporters (CJS) geht an das Stück »Springy« von Benjamin Schaefer. Der Pianist und Komponist ist Absolvent der Musikhochschule Köln und war Mitglied des Landesjazzorchesters NRW und des Bundesjazzorchesters (BuJazzO). Er hat über die letzten zwanzig Jahre zwölf Alben veröffentlicht und eine Reihe von Bands geleitet, aktuell Stone Flowers. Er hat schon eine Vielzahl von Preisen gewonnen, u.a. 2011 den Jazzpreis der Stadt Köln.
Die Komposition »Baldeneyus« von Nicklas John liegt auf Platz 2. Der junge Pianist hat gerade sein Studium an der Folkwang Universität in Essen abgeschlossen. Er hat bereits eine Reihe von Preisen als Pianist und Komponist gewonnen, war Mitglied des JugendJazzOrchester NRW. Er tritt solo, mit dem Duo N.O. Trio (sic) und dem Quartett Eines Tages auf.
»Wir werden wieder viele Teilnehmer*innen des Wettbewerbs zu Konzerten ins King Georg einladen«
Jochen Axer
Maik Krahl gewinnt den dritten Preis mit seinem Stück »Le Pin Sec«. Er studierte in Dresden und Essen und zählt heute zu den herausragenden deutschen Jazz-Trompetern. Er hat bereits drei Alben unter eigenem Namen veröffentlicht und ist seit Jahren festes Mitglied des Kölner Subway Jazz Orchestra.
Der Wettbewerb ist mit Geldpreisen von € 1.500, € 1.000 und € 500 plus Auftritten im King Georg dotiert. Die dreiköpfige Jury mit Martin Sasse (Vorsitzender), der aktuellen WDR Jazzpreisträgerin Caris Hermes und dem Vorjahresgewinner Ole Sinell bewertete blind, also ohne Kenntnis der Namen der Komponisten.
Jury-Vorsitzender und künstlerischer Leiter des King Georg Martin Sasse: „Es war nicht einfach für die Jury, eine Auswahl zu treffen. Am Ende fühlen wir uns mit den drei Gewinnern sehr wohl.«
CJS-Vorsitzender und Betreiber des King Georg Dr. Jochen Axer: »43 Einreichungen zeigen uns, dass der Wettbewerb weiterhin gut angenommen wird. Das ist ganz im Sinne der CJS als gemeinnützigem Verein zur Förderung des Jazz in Köln und Umgebung. Wir werden wieder viele TeilnehmerInnen des Wettbewerbs zu Konzerten ins King Georg einladen.«
Jazz fürs Publikum – überall. Kommt mit uns nach Bad Honnef zu »R(h)einjazz und »Musik im Pavillon«, auf das malerische Rittergut Orr in Pulheim oder in eine umfunktionierte Kirche in Köln-Sülz/Klettenberg.

Diese Neuigkeit sollte sich bereits herumgesprochen haben: Das King Georg-Programm expandiert. Schon klar, werdet ihr denken, viel mehr Programm als jetzt passt kaum in unseren kleinen aber feinen Lieblingsklub. Genauso ist es auch. Also auf zu neuen Ufern! So dürfen wir bekanntgeben, dass wir unter dem Motto »King Georg On Tour« Konzerte im Rahmen von »R(h)einjazz« sowie Musik im Pavillon« in Bad Honnef, auf dem Rittergut Orr in Pulheim und im Event-Room Ventana in der profanisierten Waisenhaus-Kirche in Köln-Sülz/Klettenberg mitpräsentieren. Jazz fürs Publikum. Im klimatisierten Club und Open air. Frühlingsgefühle für alle Fans von Straight ahead, modern & more – und der Sommer kann kommen.
R(h)einjazz
Location: Lilo im alten Hallenbad, Rheinpromenade 4, 53604 Bad Honnef
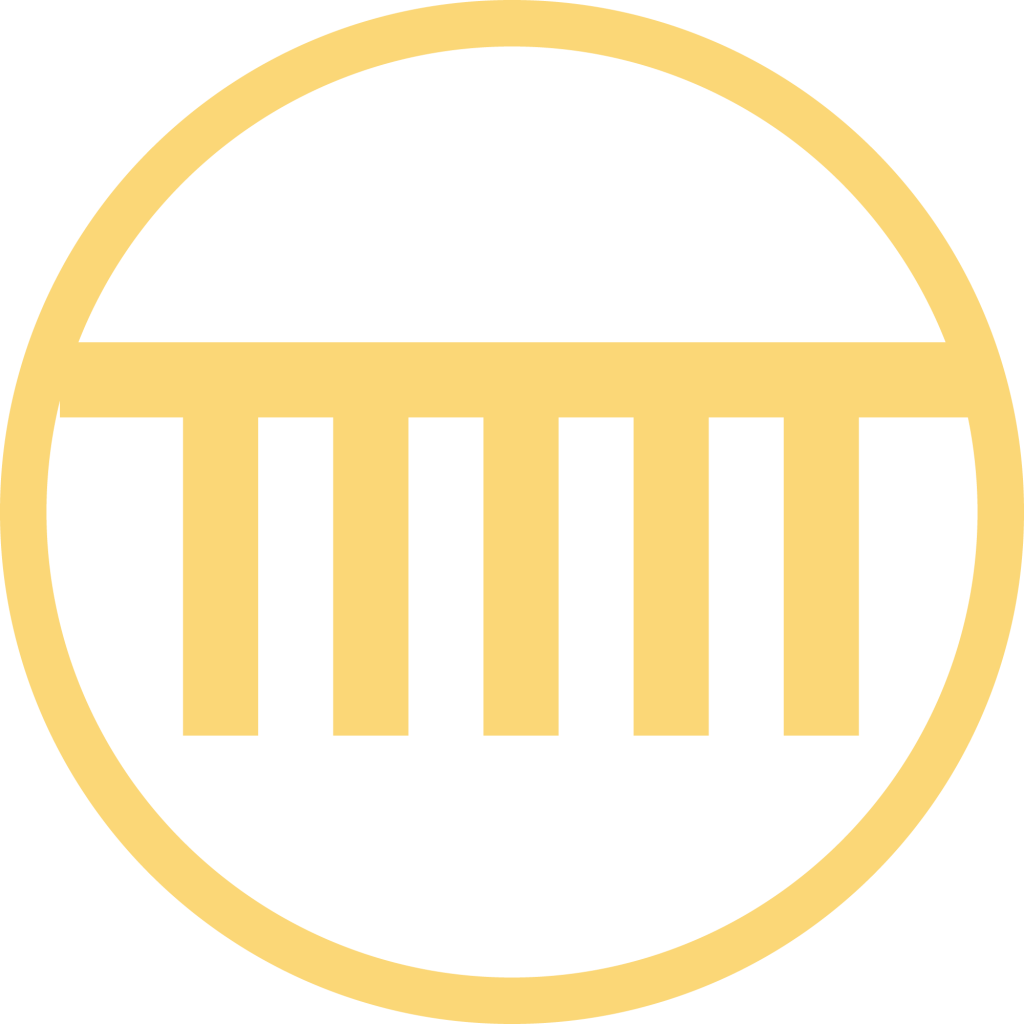
Das Lilo eröffnete im Jahr 2022 im Gebäudekomplex des ehemaligen Hallenbads in Bad Honnef erstmals seine Türen. Heute bietet es seinen Besuchern eine Reihe von Freizeitangeboten – ein einzigartiger Ort für Sport, Kultur und Miteinander.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Musik im Pavillon
Location: Pavillon Ziepchesplatz Open Air, Löwenburgstraße 21, 53604 Bad Honnef
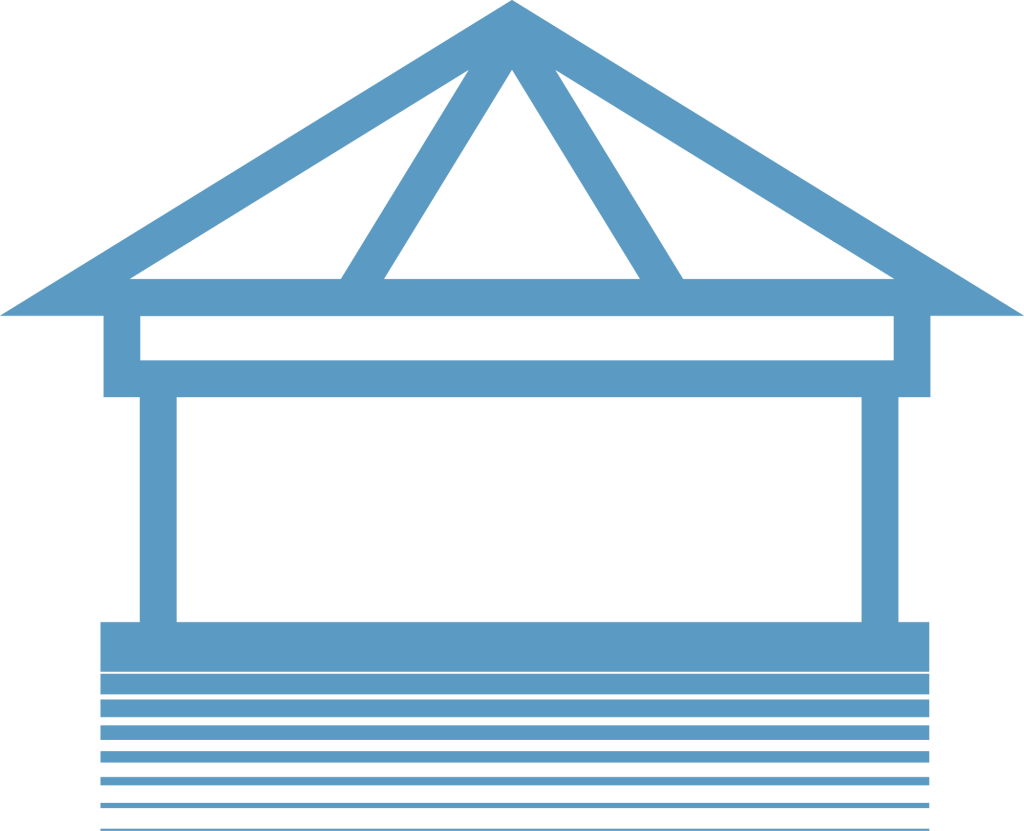
Die Reihe Musik im Pavillon feiert in diesem Jahr 5-jähriges Jubiläum!
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Rittergut Orr
Location: Haus Orr, Orrer Str., 50259 Pulheim
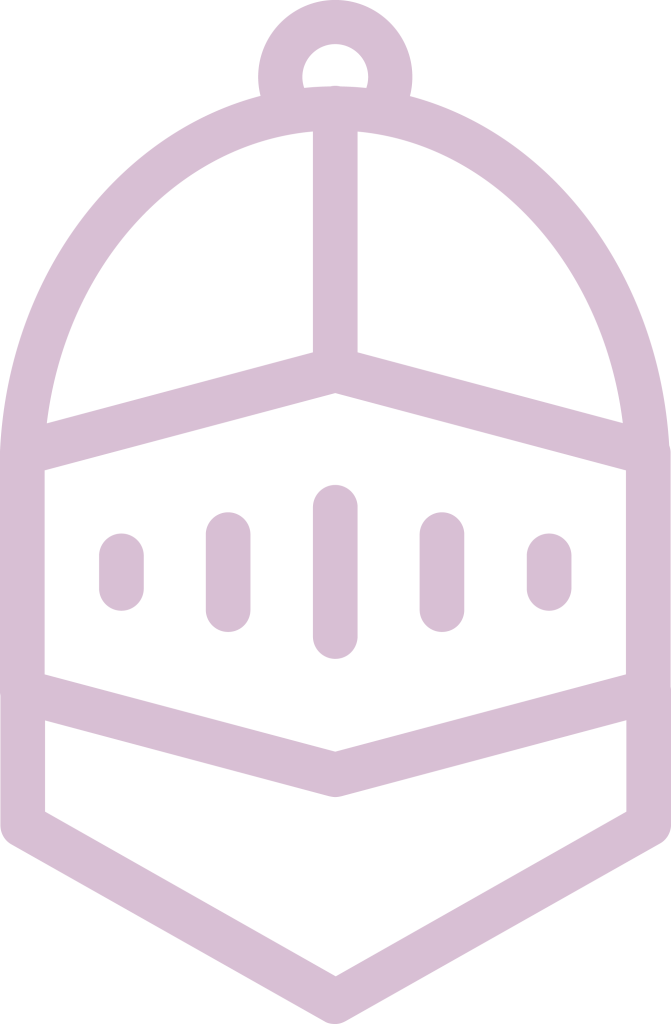
Die JazzLounge im Rittergut Orr ist ein Ort, an dem sich erstklassige Jazzmusiker*innen aus der Region und darüber hinaus versammeln, um uns unvergessliche Abende voller Musik und Unterhaltung zu bieten. Von traditionellem Swing über zeitgenössischen Fusion-Jazz bis hin zu melodischen Balladen.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ventana
Location: Elisabeth-von-Mumm-Platz 1, 50937 Köln

Last not least laden wir ein in die ganz besondere Atmosphäre der profanisierten Waisenhaus-Kirche in Köln-Sülz/Klettenberg und den dortigen Ventana-Event-Room.
ALLE TERMINE AUF EINEN BLICK (TBA)
Letztes Jahr wäre Amy Winehouse 40 Jahre alt geworden. Das Biopic »Back to Black« (Kinostart: 11. April) ist ein netter Versuch, ihr kurzes Leben anhand ihrer Songs zu erzählen.

Es ist nicht einfach, das Leben von Amy Winehouse zu verfilmen, gerade weil es so kurz war. Viele Fallstricke liegen auf dem Weg zu einem Biopic, das der britischen Sängerin gerecht werden würde, die nach steiler und doch steiniger Karriere als Folge einer Alkoholvergiftung 2011 für immer dem Klub 27 beigetreten ist. Neben anderen im Alter von 27 Jahren verstorbenen Popstars wie Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison und Kurt Cobain wird Amy Winehouse bekanntlich zu diesem erlauchten Kreis von zweifelhaftem Ruf gezählt. Auch Blues-Legende Robert Johnson und Jazz-Trompeter Richard Turner wurden in ihm aufgenommen, und es soll Britney-Spears-Fans gegen, die in der Nacht vor deren 28. Geburtstag extraviele Gebete gen Himmel schickten, damit die ebenfalls von Exzessen und Erschöpfungszuständen gebeutelte Britney nicht in letzter Sekunde ihr Ticket für den ominösen Klub lösen würde. Die Schwierigkeit, Amy Winehouse in einem Kinofilm ohne dokumentarischen Anspruch gerecht zu werden (also anders als Asif Kapadias Filmporträt »Amy«, dessen Titel allein eine gewisse Intimität vermuten lässt, die nie eingelöst wird), besteht darin, die Fülle an Details, aus der sich ihre Live-Fast-Die-Young-Biografie zusammensetzt, und damit das breite Spektrum an Gründen für ihr frühes Ableben, in die überschaubare erzählte Zeit ihrer wenigen Lebensjahre hineinzupacken – und das auch noch in der knapp bemessenen Erzählzeit eines Unterhaltungsfilms.
Wenig Luft zum Atmen
Regisseurin Sam Taylor-Johnson beansprucht die Aufmerksamkeitsspanne des Publikums für beinahe genau zwei Stunden – und auch bereits in ihrer Wahl des Filmtitels, »Back To Black«, steckt ein Fingerzeig auf die geradezu körperliche Nähe, die sie – ähnlich wie Kapadia, aber wesentlich ehrlicher – zur real existierenden Heldin ihres Spielfilms sucht. Schließlich handelt es sich um das Zitat eines sehr persönlichen Songs von Amy Winehouse, in dem sie nicht irgendeinen Schwank aus ihrem Alltag erzählt, sondern eine depressive Phase rekapituliert, in der ihre von Drogen verseuchte On-Off-Beziehung zum Gatten Blake Fielder-Civil mal wieder aus dem Ruder läuft. Zudem entschied sich Taylor-Johnson für ein Höchstmaß an behaupteter Authentizität, indem sie Hauptdarstellerin Marisa Abela noch weniger Luft zum Atmen ließ bei der Interpretation der Hauptrolle, als man etwa Rami Malek für seine Verkörperung Freddie Mercurys in »Bohemian Rhapsody« zugestanden hatte. Zwar gewann Malek damals den Oscar für den besten männlichen Hauptdarsteller, musste sich diese Auszeichnung aber mindestens teilen mit dem inoffiziellen Gewinner des Oscars für den beliebtesten Geist eines Popstars in einem Biopic: Freddie Mercury.
Marisa Abela nutzt das bisschen Luft, das man ihr unter Amy-Look und Amy-Habitus noch gab, für die Reproduktion von Amy Winehouse’ Stimme. Tja, finde den Fehler. Natürlich lässt die sich nicht nachahmen, aber die Story des Films entfaltet sich nun mal anhand von Winehouse-Songtexten – da muss (oder darf) die junge Schauspielerin durch. Das macht sie gut, auch wenn einem gerade durch diesen Drehbuch-Kniff und die damit zusammenhängenden Marisa Abela/Amy Winehouse-Gesangsperformances klar wird, dass Amy Winehouse‘ Mentalität, alles persönlich zu nehmen, die in diesen Songs zum Ausdruck kommt, heute vielmehr Teil ihres Images als ihrer wie auch immer gearteten wahren Persönlichkeit ist. Nun, die geht uns ja auch gar nichts an. Wenn die noch lebende Amy Winehouse eine Kippfigur auf der Schwelle zwischen Star der alten Schule (dem Alltag enthoben) und Celebrity der heutigen Zeit (dem Alltag verpflichtet) war, unentschieden, auf welche Seite sie sich schlagen soll, so wie sie in der besten Szene des Films im Bühnengraben vor ihren Fans beziehungsweise am Abgrund ihrer Karriere balanciert, dann können wir froh sein, dass uns Taylor-Johnson nicht zu tief in den Moloch ihrer Privatsphäre hineinzieht. Dieser Film sagt: Amy Winehouse bleibt für immer ein Star. Basta.
Die lyrische Amy
Der Verzicht auf ihre »echten« Dämonen führt natürlich zu einem geringeren Maß an Intensität, denn ohne die hätte die »echte« Amy Winehouse ihre Songs niemals schreiben und singen können. Die Einblicke in private Momente sind in »Back to Black« eher von oberflächlicher Art – gemeint ist etwa die fürs Publikum durchaus unterhaltsame Kennenlern-Sequenz von Blake und Amy. Alles scheint so, wie Fans und andere Phantasten sie sich ausmalen würden, oder wie Amy selbst es in ihren Songs durch ein lyrisches Ich (bitte nicht vergessen) für uns aufbereitet hat. Einzige Ausnahme ist womöglich die kurze Sequenz, in der Amy Winehouse‘ jüdische Familie singt, bevor sie aus diesem jüdischen Background schlüpft wie aus einem zu engen Kleid, indem sie mit ihrer Stimme den Chor der anderen zum Schweigen bringt, sodass zwar ihre Großmutter Cynthia als Role Model und ihr Vater als Mentor/Manager wichtig bleiben, ihre Jewishness aber auch im Folgenden keine Rolle mehr spielt.
Die reale Amy Winheouse und ihr lyrisches Ich mögen einander ähnlich gewesen sein wie eineiige Zwillinge – das macht sie noch nicht zu einer einzigen Person. Genauso wenig wie eine sich ihr in fast allen äußerlichen sowie am Markt veräußerten Merkmalen annähernde Darstellerin nicht doch eine riesige Lücke hinterließe zwischen sich und dem Vorbild. Diese Lücke dürfen wir selbst mit unserer Vorstellung füllen, wer Amy Winehouse gewesen sein mag. Klar, ihre Lieder sind nicht von ihrem coolen Selbstbewusstsein zu trennen, dass sie etwa dem ersten Manager oder den Plattenfirmen-Macho-Bossen gegenüber an den Tag legt – so macht sie im Film gleich klar, dass sie sich eher in einer Reihe mit Sarah Lois Vaughan als mit den Spice Girls sieht. Auch sind ihre Songs nicht zu trennen von der Geschichte ihrer tragischen Partnerwahl und des Drogenkonsums, der sie an die Schwelle des Klub 27 brachte, lange bevor sie tatsächlich durch dessen Tür fiel. Aber ihre Songs bleiben lange Momente, die die Zuhörenden von dem zu trennen in der Lage sind, was sie selbst im Alltag zu bewältigen haben und die gleichzeitig nicht behaupten, dass der Alltag unwichtig wäre. Sam Taylor-Johnsons Biopic ist letztlich weniger eine Hommage an Amy Winehouse als eine Erinnerung daran, dass solche großartigen Momente durch Popmusik möglich sind. Wirklich erleben kann man sie in »Back to Black« allerdings nicht. Dafür ist der Film ein bisschen zu nett.
Text: Wolfgang Frömberg, Foto: Studiocanal/ Dean Rogers
Erinnerung an die 1990 verstorbene Sarah Lois Vaughan, eine phänomenale Stimme des Jazz, die am 27. März 1924 geboren wurde.

Mehrmals hat sie sich selbst erfunden, war Pianistin, Mitbegründerin des Bebop, chargierte zwischen eher kommerziellem Pop und Jazz, ließ sich nicht in Schubladen stecken war erfolgreich und aktiv zwischen 1945 und 1990. Sie gehört zu den großen Diven des Jazz, gemeinsam mit Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Aretha Franklin, Bessie Smith, Mahalia Jackson … und aus neuerer Zeit Dee Dee Bridgewater und Samara Joy …. für viele ihrer Fans ist Sarah Vaughan unerreicht.
Die Musikkritik sei zitiert: »Bei perfekter Intonation auch in weitintervallisch aufgebauten Improvisationslinien und einer atemberaubenden Flexibilität reichte diese Stimme über drei Oktaven vom Alt- in den höchsten Sopranbereich.« Eine Stimme als Melodieinstrument – das war das Selbstverständnis von Sarah Vaughan. Zwei Video-Aufnahmen von 1958 und 1964 mit zwei Klassikern (»Misty« und »Somewhere Over The Rainbow«) sollen die optische Erinnerung auffrischen, die Zusammenstellung weiterer berühmter von Sarah Vaughan gesungener Songs, beginnend mit »Lullaby of Birdland« und »What A Difference A Day Made« verdeutlichen das Können und die
überragenden gesanglichen Fähigkeiten dieser Sängerin.
»Misty« (Schweden 1964)
»Somewhere Over The Rainbow« (Holland 1958)
»Lullaby of Birdland«, »What A Difference A Day Made«…. und viele andere
RIP Sarah Lois Vaughan (gestorben am 3.April 1990)
Text: Jochen Axer, Foto: William P. Gottlieb/Library of Congress, USA, Creative Commons
Glenn Miller wurde am 1. März 1904 in Clarinda, Iowa, geboren – und starb 1944. Sein Glenn Miller Orchestra begeisterte mit Hits wie »In the Mood«, »Moonlight Serenade« und »Chattanooga Choo Choo«.

In seiner nur rund 25jährigen Karriere wurde geborene 1904 Glenn Miller zum herausragenden Vertreter des »weißen« Bigband-Swing. Seine Musik war für ihre eingängigen Melodien, präzisen Arrangements und den unverwechselbaren Sound der Bläsersektion bekannt. Sein Glenn Miller Orchestra begeisterte mit Hits wie »In the Mood«, »Moonlight Serenade« und »Chattanooga Choo Choo« Menschen in aller Welt. Mit seinem klaren Fokus auf Tanzmusik waren die Musik und Auftritte für ein breites Publikum gedacht, was er live und über das Radio erreichte. Miller war Pionier in der Verwendung von Streichern innerhalb einer Bigband, was zu einem reicheren und nuancierteren Klangbild führte. Trotz seines Erfolgs galt Glenn Miller als bescheiden und bodenständig, der stets den Kontakt mit dem Publikum suchte. Nicht zuletzt deshalb erwarb er sich große Beliebtheit beim überwiegend weißen Publikum – neben Benny Goodman und Artie Shaw -, und in Abgrenzung zu den schwarzen Big Bands von Fletcher Henderson, Chick Webb und Count Basie, die besonders in Harlem und Kansas City spielten.
Arrangeur und Bandleader
Glenn Miller war weniger Komponist als vielmehr Arrangeur und Bandleader, der die Perfektion liebte. Seine Erkennungsmelodie Moonlight Serenade ist von ihm selbst, aber sogar »In the Mood« nicht von ihm, sondern von Joe Garland.
Als strikter Gegner des Nationalsozialismus ging er mitten in seiner größten Erfolgszeit einen Tag nach dem Angriff auf Pearl Habour 1942 zur US-Army und leitete im Rang eines Captain (Hauptmann) das durchaus »jazzige« Army Air Force Orchestra. Unter bislang nicht völlig geklärten Umständen starb er bei einem Flugzeugabsturz am 15. März 1944 mit nur 37 Jahren.
Nach Millers Tod wurde ein ziviles Glenn Miller Orchestra vom langjährigen Band-Saxophonisten und -Sänger Tex Beneke aufgebaut; Pianist der Band wurde der zukünftige Filmkomponist Henry Mancini, der auch für diverse Arrangements verantwortlich war. Diese 1956 entstandene Band bildet heute das offizielle Glenn Miller Orchestra in den Vereinigten Staaten, daneben gibt es nur noch zwei weitere Orchester in Europa und England, die Glenn Miller Melodien und Arrangements spielen dürfen.
Botschaft für Optimismus
Seine für viele Jazzfans nicht überzeugende, aber überaus massentaugliche Musik, seine Bescheidenheit, seine klare politische Haltung machten Glenn Miller zur Legende, nicht nur in Amerika, sondern auch in Europa: Seine Musik wurde verstanden als Botschaft für Optimismus, Lebensfreude und Freiheit. Die Bedeutung wird durch den ihn würdigenden Film die »Die Glenn Miller Story« aus dem Jahr 1953 mit James Stewart in der Hauptrolle deutlich.
Eine Hommage an ihn mit einigen seinen berühmtesten Einspielungen – es gibt wenig Bildmaterial – und die Bilder können auch nicht verhehlen, über 80 Jahre alt zu sein und aus einer anderen Zeit zu stammen. Umso beeindruckender, dass der Sound und die Melodien immer noch als großartige Swing-Tanzmusik uneingeschränkt präsent sind.
»In The Mood« (1941)
»Chattanooga Choo Choo« (1941 – aus: Sun Valley Serenade)
»Moonlight Serenade« (1941)
Und diese Präsenz mag derjenige, der Lust hat, gerne auch heute noch live erleben mit dem Glenn Miller Orchestra, hier ein vollständiges Konzert aus dem Avalon Theater in Paris aus dem Jahr 2021
0:00 – Moonlight Serenad
1:10 – 705
4:00 – Chattanooga Choo Choo
13:13 – Stairway to the Stars
18:16 – A String of Pearls
23:45 – A-Tisket A-Tasket
27:49 – Stars Fell On Alabama
34:48 – Tuxedo Junction
40:11 – Benny Rides Again
46:49 – Perfidia
51:51 – Love Me Or Leave Me
59:00 – Glenn’s American Patrol
1:02:31 – INTERMISSION
1:20:05 – Little Brown Jug
1:25:00 – PEnnsylvania 6-5000
1:29:14 – I Know Why And So Do You
1:32:50 – I Won’t Dance
1:38:58 – Don’t Sit Under the Apple Tree (With Anyone Else But Me)
1:42:37 – In The Mood
1:46:26 – Moonlight Serenade
1:50:00 – ENCORE: Anvil Chorus
Text: Jochen Axer
Der Mann für die richtigen Vibes: Vibraphonist Gary Burton wurde am 23. Januar 1943 geboren.

Am 23. Januar 1943 wurde Gary Burton in Indiana geboren; schon mit 17 Jahren veröffentlichte er seine erste Schallplatte unter eigenem Namen »New Vibe Man In Town« – sehr bezeichnend (mit Gene Cherico und Joe Morello) – und setzte sich fortan als »neuer«, superjunger und überragender Vibraphonist durch… mit seiner autodidaktisch erlernten Technik mit vier Schlägeln.
Burton spielte in sehr unterschiedlichen Stilen und mit einer Vielzahl von stilprägenden Künstlern – sein Einfluss auf die Jazzentwicklung kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden.
Ein großes Stück seines Weges ging er mit Stan Getz, hier eine Aufnahme aus einem Konzert 1966 in Berlin mit Getz und Astrud Gilberto.
Intensiv arbeitete er mit Keith Jarrett, hier eine Aufnahme aus dem Jahr 1971
Für den Titel Alone At Last erhielt Burton 1973 einen Grammy für die Beste Jazz-Darbietung eines Solisten.
Ihm ging es immer darum, auch das junge Publikum zu erreichn und zu begeistern – das war der Hintergrund für sein Quartett in Rockformation mit Steve Swallow (b), Larry Coryell (git) und Roy Haynes oder Bob Moses (dr) Hier eine Aufnahme mit Pat Metheny
Mehrere Auszeichnungen erhielt er für sein Zusammenspiel mit Chick Corea (hier Chrystal Silence)
Und mit Chick Corea auch eine wunderbare intime Aufnahme aus dem Jahr 2016
Seinen Abschied erklärte er vor jetzt sieben Jahren im Jahr 2017. Souverän und bescheiden mit der Haltung eines Mannes, der nie ganz im Vordergrund stehen musste und mit dem, was er getan und geleistet hatte, im Reinen ist. Chapeau, Gary Burton!
Text: Jochen Axer
Am 10. Januar 1924 wurde einer der größten Schlagzeuger des 20. Jahrhunderts geboren. Der 2007 verstorbene Max Roach beeinflusste die Jazzgeschichte in vielfacher Weise.

Maxwell Lemuel »Max“ Roach« (geboren am 10. Januar 1924, gestorben am 16. August 2007) ist für mich einer der Schlagzeuger des 20. Jahrhunderts. Er spielte unter anderem mit Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Duke Ellington, Charles Mingus, Miles Davis und Sonny Rollins. Er schuf mit den Genannten den Hardbop-Stil und beeinflusste musikalisch durch seine Kompositionen und seine Haltung die Geschichte des Jazz in vielfältiger Weise.
Ich beginne mit meinem Highlight, vielleicht nicht so bekannt, nämlich dem Drum Battle mit Buddy Rich aus dem Jahr 1954. Auf dieser Aufnahme ist neben der Virtuosität beider Schlagzeuger deren Unterschiedlichkeit deutlich zu hören – Buddy als der überragende Techniker, Max Roach als der differenziertere Musiker.
B̲u̲d̲d̲y̲ ̲R̲i̲c̲h̲ ̲&̲ ̲M̲a̲x̲ ̲R̲o̲a̲c̲h̲ ̲̲–̲ ̲R̲i̲c̲h̲ ̲V̲e̲r̲s̲u̲s̲ ̲R̲o̲a̲c̲h̲ ̲(̲1̲9̲5̲9̲)̲
Tracklist:
Sing, Sing, Sing0:00:00
Sing, Sing, Sing 0:04:26
The Casbah 0:08:40
The Casbah 0:13:12
Sleep 0:18:15
Figure Eights 0:21:38
Yesterdays 0:26:13
Big Foot 0:31:59
Big Foot 0:37:04
Limehouse Blues 0:42:23
Limehouse Blues0:46:22
Toot, Toot, Tootsie Goodbye 0:50:10
Besetzung.
Alto Saxophone [Left Channel] – Phil Woods
Bass [Left Channel] – Phil Leshin
Bass [Right Channel] – Bobby Boswell
Drums [Left Channel] – B̲u̲d̲d̲y̲ ̲R̲i̲c̲h̲
Drums [Right Channel] – M̲a̲x̲ ̲R̲o̲a̲c̲h̲
Ensemble [Left Channel] – B̲u̲d̲d̲y̲ ̲R̲i̲c̲h̲ Quintet
Ensemble [Right Channel] – M̲a̲x̲ ̲R̲o̲a̲c̲h̲ Quintet
Piano [Left Channel] – John Bunch
Tenor Saxophone [Right Channel] – Stanley Turrentine
Trombone [Left Channel] – Willie Dennis
Trombone [Right Channel] – Julian Priester
Trumpet [Right Channel] – Tommy Turrentine
Recorded in New York, Early Spring, 1959.
Im Jahr 1952 gründete Max Roach zusammen mit Charles Mingus das erste Independent-Label (Debut Records) in Musikerbesitz und spielte 1953 auch sein eigenes Debüt als Bandleader mit dem Saxophonisten Hank Mobley ein.(The Max Roach Quartet featuring Hank Mobley)
T̲h̲e̲ ̲M̲a̲x̲ ̲R̲o̲a̲c̲h̲ ̲Q̲u̲a̲r̲t̲e̲t̲ ̲F̲e̲a̲t̲u̲r̲i̲n̲g̲ ̲H̲a̲n̲k̲ ̲M̲o̲b̲l̲e̲y̲ ̲̲(̲1̲9̲5̲3̲)̲
Tracklist:
Cou-Manchi-Cou 0:00:00
Just One Of Those Things 0:03:03
Glow Worm 0:06:13
Mobleyzation 0:08:42
Chi-Chi 0:11:26
Kismet 0:14:26
I’m A Fool To Want You 0:17:07
Sfax 0:20:22
Orientation 0:22:41
Drum Conversation 0:25:33
Drum Conversation (Part 2) 0:28:17
(Besetzung:
Alto Saxophone – Gigi Gryce (tracks: 3, 4, 8, 9)
Bass – Franklin Skeete
Drums –M̲a̲x̲ ̲R̲o̲a̲c̲h̲
Piano – Walter Davis II
Tenor Saxophone – Hank Mobley
Trombone – Leon Comegys (tracks: 3, 4, 8, 9)
Trumpet – Idrees Sulieman (tracks: 3, 4, 8, 9)
(Recorded in New York on April 10, 1953)
Mit Mingus nahm er auch das denkwürdige Jazz at Massey Hall-Konzert 1953 mit Parker, Gillespie und Bud Powell auf, das für viele als das »Greatest Jazz Concert Ever« gilt.
P̲e̲r̲d̲i̲d̲o̲ ̲ 0:00:02
S̲a̲l̲t̲ ̲P̲e̲a̲n̲u̲t̲s̲ ̲ 0:07:48
A̲l̲l̲ ̲T̲h̲e̲ ̲T̲h̲i̲n̲g̲s̲ ̲Y̲o̲u̲ ̲A̲r̲e̲/̲5̲2̲n̲d̲ ̲S̲t̲r̲e̲e̲t̲ ̲T̲h̲e̲m̲e̲ ̲ 0:15:32
W̲e̲e̲ ̲(̲A̲l̲l̲e̲n̲’̲s̲ ̲A̲l̲l̲e̲y̲)̲ ̲ 0:23:27
H̲o̲t̲ ̲H̲o̲u̲s̲e̲ ̲ 0:30:13
A̲ ̲N̲i̲g̲h̲t̲ ̲I̲n̲ ̲T̲u̲n̲i̲s̲i̲a̲ 0:39:30
Besetzung (Alto Saxophone – Charlie Parker; Bass – Charlie Mingus; Drums – Max Roach; Piano – Bud Powell; Trumpet – Dizzy Gillespie)
Und schon bald entwickelte er mit Clifford Brown, Sonny Rollin und Richie Powell den Hard Bop Stil.
(Besetzung: #1-5: Clifford Brown (tp), Teddy Edwards (ts), Carl Perkins (p), George Bledsoe (b), and Max Roach (d); #6-9: Clifford Brown (tp), Harold Land (ts), Richie Powell (p), George Morrow (b), and Max Roach (d)
Intro by Gene Norman & Max Roach 1:01
All God’s Chillun Got Rhythm 6:18
Tenderly 5:25
Sunset Eyes 6:40
Clifford’s Axe 7:15
Jordu 10:09
I Can’t Get Started With You 4:04
I Get A Kick Out Of You 8:37
Parisian Thoroughfare 7:45
(Recorded at the Pasadena Civic Auditorium, Los Angeles, April 1954, and at the Shrine Auditorium, Hollywood, on August 30, 1954)
1960 nahm er das Konzeptalbum We Insist! Freedom Now Suite auf, in dem er mit Coleman Hawkins, Babatunde Olatunji und der Sängerin Abbey Lincoln die politische Botschaft der Bürgerrechtsbewegung umsetzte Wegen dieser Aufnahme wurde Roach in den 1960er Jahren von den Plattenfirmen boykottiert.
Max Roach – We Insist! Freedom Now Suite (1960)
Bass – James Schenck (tracks: A1, A2, B1, B2)
Congas (Conga Drums) – Michael Olatunji (tracks: B1, B2)
Drums – Max Roach
Percussion – Raymond Mantillo (tracks: B1, B2), Tomas du Vall (tracks: B1, B2) Tenor Saxophone – Coleman Hawkins (tracks: A1),
Walter Benton (tracks: A1, A2, B1, B2)
Trombone – Julian Priester (tracks: A1, A2, B1, B2)
Trumpet – Booker Little (tracks: A1, A2, B1, B2)
Vocals – Abbey Lincoln
Driva’ Man 0:00
Freedom Day 5:19
Triptych: Prayer, Protest, Peace 11:30
All Africa 19:40
Tears For Johannesburg 27:43
Hier auch in einer (verkürzten) Aufnahme des belgischen Fernsehens aus 1964:
Max Roach ist mit Recht: hochdekoriert: Er erhielt die Jazz Masters Fellowship 1984 als höchste Auszeichnung für Jazzmusiker in den USA., 1988 MacArthur Fellow, 1991 Ehrenmitglied der American Academy of Arts and Letters gewählt, die University of Pennsylvania verlieh ihm 2004 die Ehrendoktorwürde.
Ich verehre Ihn, Max Roach – RIP
Text: Jochen Axer

Sehr gerne hören wir immer wieder den wunderbaren Interviews zu, die Judy Carmichael unter dem Titel »Jazz Inspired« mit Musiker*innen und Künstler*innen aus aller Welt führt. Jeder kann diese Interviews auf Judys Seite anhören. Toll wäre es, wenn ihr mit einer Spende die ausschließlich privat getragene Aktivität von ihr unterstützt – genauso wie unsere Arbeit für den Jazz.
Heute möchten wir euch auf die Folge aus dem Jahr 2020 mit Hendrik Meurkens hinweisen, die kurz
nach den Aufnahmen für das Album »Cobb´s Pocket« mit Peter Bernstein, Mike LeDonne und Jimmy Cobb stattfand. Hendrik Meurkens war schon mehrfach bei uns im King Georg –und hoffentlich bald wieder – in unserem Archiv findet ihr seine Live-Auftritte. Er ist der herausragende Mundharmonika-Spieler des Jazz in Nachfolge von Toots Thielemans.
Er brachte den Jazz nach Europa. Am 1. Januar 2024 wäre der 2021 verstorbene Ack van Rooyen 94 Jahre alt geworden.

Der Niederländer hat gemeinsam mit seinem Bruder Jerry großen Anteil daran, den Jazz nach Europa gebracht zu haben. Nach Stationen in NY als Student und dem ersten kontakt mit dem Bebop, seinem Studium in Den Haag und seinem Karrierebeginn in Paris war er 1960 Mitbegründer der Bigband des Senders Freies Berlin, wechselte 1966 nach Stuttgart zur SWR Bigband, der Bert Kaempfert Big Band, den Skymasters – bereits 1975 war er Gründungsmitglied des United Jazz and Rock Ensembles und Peter Herbolzheimers Rhythm Combination and Brass.
Sein Spiel auf Trompete und Flügelhorn war – und ist – legendär. Häufig hat er auch in Köln gespielt. Im King Georg hatten wir das Glück, ihn am 08. Januar 2020 hören zu dürfen, kurz nach dem Start unseres Konzertprogramms – und ebenso kurz vor der pandemiebedingten Schließung! Leider hatten wir damals noch keine Idee zu streamen…… Ich werde diesen Abend nicht vergessen, nicht zuletzt wegen der Stunde mit ihm an der Bar nach dem Konzert – zugewandt, überaus freundlich, entspannt, gleichzeitig ernsthaft und klug, selbst beim Bier…
Also deshalb ein anderes Konzert aus dem Bimhuis anlässlich seines 90. Geburtstages, das aber seine Intensität, seine Lyrik, seine Energie auch im hohen Alter deutlich werden lässt (mit Fay Claassen (voc), Paul Heller (sax), Bart van Lier (trb), Peter Tiehuis (g), Juraj Stanik (p), Ruud Ouwehand (b) und Hans Dekker (dr))
Und hier noch ein Interview:
Ein großartiger Künstler und beeindruckender Mensch, der am 18. November 2021 verstarb.
Text: Jochen Axer