Das ist sicher eines der bekanntesten Themen der Musik- und Filmgeschichte. Und hier kann ich starten mit einer Kombination der Musik mit Filmschnipseln aus dem 1987– und das Saxofon-Solo spielt niemand anders als Don Menza, der uns am 7. Juni im King Georg die Ehre gibt.
Gleichzeitig gilt die Ehre natürlich wie immer dem Original mit dem Saxofon-Solo von Plas Johnson. Hier das Original als Audio mit einigen weiteren hörenswerten Stücken von Henry Mancini…
00:00 The Pink Panther Theme
02:39 It Had Better Be Tonight (Instrumental)
04:26 Royal Blue
07:39 Champagne And Quail
10:28 The Village Inn
13:06 The Tiber Twist
15:58 It Had Better Be Tonight (Vocal)
17:58 Cortina
19:55 The Lonely Princess
22:25 Something For Sellers
25:14 Piano And Strings
27:51 Shades Of Sennett
Unter all den berühmten Musikstücken Henry Mancinis dürfte »The Pink Panther Theme« vermutlich den Spitzenplatz einnehmen, was Bekanntheit und Wiedererkennungswert betrifft. Das jazzige Titelstück aus Blake Edwards‘ Komödie um den tolpatschigen Inspektor Clouseau und den englischen Meisterdieb Sir Charles Lytton ist ein Klassiker der Filmmusikgeschichte. Es wurde zudem als Eingangsmelodie für die aus dem Vorspann des Films hervorgegangene Zeichentrickserie genutzt, die über Jahre hinweg im deutschen Fernsehen ausgestrahlt wurde, und machte Generationen von Kindern mit Mancinis Musik bekannt.
Henry Mancini wurde für »The Pink Pantherv Theme« mit drei Grammys ausgezeichnet und für den Oscar nominiert.
Denn zu deren Geburtszeiten erblickte auch dieser Boadway-Song aus dem Musical »Everybody´s Welcome« das Licht der Welt: 1931 von Herman Hupfeld, bekannt geworden 1942 durch den Film-klassiker »Casablanca«. Man mag gar nicht die beste Version auswähle, so oft ist der Song gespielt worden. Neben Frank Sinatra:

Jochen Axer, Unterstützer des King Georg und über die Cologne Jazz Supporters Förderer vieler weiterer Jazz-Projekte, stellt hier jeden Sonntag einen seiner Favoriten vor.
Über das legendäre Label Blue Note wurden schon einige Bücher geschrieben. Es lohnt sich, auch mal ein paar Worte zur Cover-Gestaltung der dort veröffentlichten Alben zu verlieren. Sie haben schließlich viel zu erzählen.

Von rechts unten biegt sich ein Schwanenhals ins Bild. Ein großer Schwung, der von einer archaisch anmutenden Apparatur abgeschlossen wird. Es ist ein feines Leuchten, das dieses Rohr, die Schraube, das Blättchen begleitet. Dahinter beziehungsweise an dessen Spitze anfangend: ein tiefes Schwarz, ein Schatten. Daraus poppt ein Ohr hervor und dann ein Gesicht. Der Mann, der da mit tiefem Schlagschatten inszeniert wird, heißt John Coltrane – sein Name steht oben drüber. Coltrane grübelt, ist in sich gekehrt, denkt nach. Es ist das Bild eines Evolutionärs, nicht eines Revolutionärs. Hier wird entwickelt, nicht zerstört. Dabei hatte natürlich auch Coltrane (späten) Anteil am Bebop-Schock, an dieser musikgeschichtlich einzigartigen Explosion.
Das sieht man hier aber nicht. Der Zeigefinger, der auf der Lippe aufliegt, wie wahrscheinlich noch wenige Momente vorher das Mundstück. Der Arm, der im Nacken die Haare reibt, die minimal tiefergelegte Stirnpartie… Ein Genie bei der Arbeit.
Das alles, diese vieldeutige Szenerie, ist in Blau getüncht. Je älter dieses Foto, das ein Plattencover ist, desto grünstichiger wird es. Das nur am Rande.
»Blue Train« von John Coltrane (1957) ist nicht nur ein Klassiker der Musikgeschichte, sondern auch eines der herausragenden Cover der Blue Note-Cover-Schmiede.
Über die Geschichte des Labels, das 1939 von zwei jüdischen deutschen Emigranten, Francis Wolff und Alfred Lion, gegründet wurde, könnte man Bücher schreiben – und das wurde bereits hinlänglich getan. Und über verschiedene Alben des Labels wurde hier im Magazin auf unserer Homepage und anderswo längst geschrieben. Wer die Klassiker der Jazz-Geschichte sucht, der kann damit seine Ausgangsrecherche starten. Die legendären und ikonischen Cover, die so immanent wichtig für den Erfolg des Labels waren, bedachte man hingegen weitaus seltener mit Worten.

Dabei gibt es gute Gründe, noch mal einen Blick (oder zwei) auf die Fotografien, die diese Cover zieren, zu werfen. Kommt ihnen doch die wichtige Aufgabe zu – das weiß jeder, der bereits im King Georg Jazz-Club war –, eine Kunst, die sich durch ihre prozessuale und immer gegenwärtige Natur auszeichnet (die Improvisation, das Live-Moment, bisweilen auch »Fehler«, die Magie und Energie), für die Nachwelt zu verewigen. Man hört beim Betrachten der Cover – sei es mit einem einzelnen Album in der Hand oder beim Entdecken bestimmter Exemplare in der Cover-Wand des King Georg –, zwar nicht die Musik, man kann sie sich aber im besten Falle vorstellen. Siehe »Blue Train«.
Oder auch das ebenso mythische Foto, das man auf der Blue Note Records Nummer 4003 findet: »Art Blakey & The Jazz Messengers – s/t« (1958). Diesmal ein fahles Gelb statt eines romantischen Blaus. Der Ausschnitt ist noch enger. Der Kopf nimmt die ganze Fläche ein. Es schiebt sich von unten nur noch das obere Revers des Anzugs, ein Hemdkragen und eine schwarze Fliege ins Bild. Ebenso konzentriert wie Coltrane aber anders alarmiert: Der trommelt wahrscheinlich gerade. Es ist ein Action-Bild, ohne dass man die Action sehen kann. Manch einer sagt Erotik dazu.
Ganz anders und im totalen Kontrast: »Free For All« (1965). Der selbe Frontman, die gleiche Formation (Kenner*innen wissen, dass nur der Name blieb. Statt Golson spielt hier Wayne Shorter, statt Reid Morgan dann Freddie Hubbard), ein kontrastierendes Szenario.
Statt stoischem Blick sind die Augen geschlossen, statt Ruhe ist hier die totale Action, Schweißperlen laufen Richtung Boden: Ekstase und Wut. Große Gefühle.

Aufgenommen, entwickelt, ausgewählt und beschnitten hat das Cover-Foto für »Free For All« Francis Wolff selbst. Er zeichnet für einen Großteil der Coverfotos der Bebop und Hard-Bop-Ära verantwortlich. Es sind Aufnahmen der Sessions, von Live-Auftritten oder auch mal von Fotoshoots. Kongenial inszeniert werden diese Fotografien von der leidenschaftlichen Arbeit des Werbegrafikers Reid Miles, der mit seinen knalligen Farben, den großen Lettern, der gesamten Typografie und den räumlichen Gestaltungen das Plattencover an und für sich revolutionierte.
Zusammen entwickelte man so einen Trademark-Look, der auch heute, 60, 70 Jahre später ins Auge fällt und Geschichten erzählt: von Künstlerpersönlichkeiten, von der Zeit, von der politischen und historischen Tapesterie, von Aufbruch oder Statik, von der Musik und allem, was sie umgibt.
Ohne reinzuhören, weiß man beim Betrachten, dass es einen Sound-ästhetischen Unterschied zwischen »Blue Train« und »Free For All« gibt. Wenn man sich das dann vor Ohren statt vor Augen führt, dann fühlt man sich bestätigt. Das ist der Zauber der Blue Note-Cover.
Text: Lars Fleischmann, Foto King Georg: Caroline Schaefer
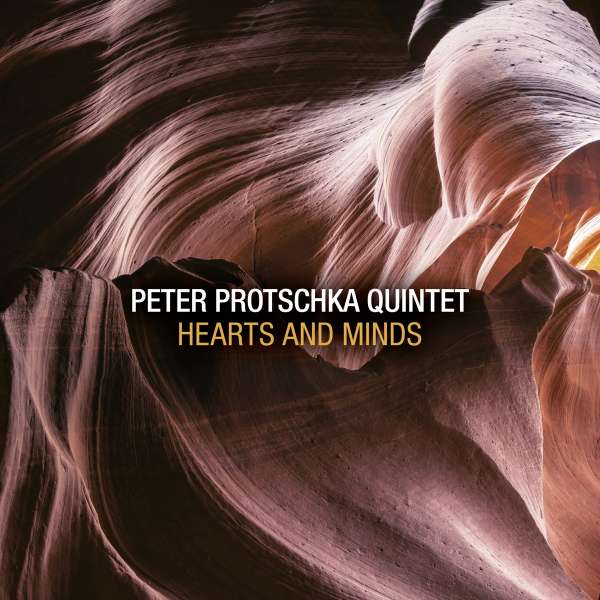
Das Quintett des Trompeters und Flügelhornisten Peter Protschka spielt in gleichbleibender Besetzung schon seit 10 Jahren zusammen. Auf dem vorliegenden Album ist zu hören, wie diese langjährige Zusammenarbeit zu einem luxuriösem Zustand der Vertrautheit geführt hat. Die Band ist »tight«. Die fünf müssen sich und den Zuhörern nichts mehr beweisen. Rick Margitzas »August in Paris« swingt genüsslich in mittlerem Tempo und wird von dem Tenorsaxofonisten und dem Flügelhornisten für gefühlvolle Solos genutzt. Pianist Martin Sasse soliert kurz und fesselnd über dem federnden Rhythmus von Bassist Martin Gjakonovski und Schlagzeuger Tobias Backhaus. Dann folgt eine melodische Gruppenimprovisation, bei der sich Protschka und Margitza elegant die Bälle zuwerfen. Die acht Stücke sind allesamt gelungene Eigenkompositionen von Protschka und Margitza, die dem Hörer ein Wohlfühlgefühl vermitteln, wie es sonst eher vielgehörte Standards tun. Dazu tragen auch die tontechnisch exzellente Aufnahme und Abmischung bei. Eindrucksvoll zeitgemäß wirkt das balladeske »Hymn For The Suffering« mit wohlgesetzten tiefen Tönen von Gjakonovski und berührenden Solos von Protschka am Flügelhorn und Sasse am Klavier. In Margitzas »E Jones« geht dann die Post ab mit Backhaus‘ swingender Beckenarbeit und Gjakonovskis mitreissendem Walking Bass. Sasse ist ganz in seinem Element, Protschka und Margitza brillieren mit inspirierten Solos. Das Album endet mit »Tom’s Groove« – just groovy!
Text: Hans-Bernd Kittlaus

Unser wöchentlicher Podcast über das Leben, die Musik und alles, was dazugehört.
36. Folge: Wolfgang Frömberg im Gespräch mit dem Jazz-Gitarristen Bruno Müller.
Foto: Gerhard Richter
Love-Songs sind eine Band, die man schwer googlen kann, und deren Sound sich nicht so leicht einordnen lässt. Aus ihren Jazz-Wurzeln schießt Kosmischer Kraut und mehr.

Love Songs, ja, das sind Liebeslieder. Love-Songs hingegen ist eine Band, die in Hamburg (und mittlerweile auch zu einem Drittel in der Bundeshauptstadt) zu Hause ist. Nein, einen Gefallen hat die Band uns als Hörer*innen mit ihrer Namenswahl echt nicht gemacht. Wer nämlich den Namen der Lovies, wie Fans sie liebevoll nennen, in Suchmaschinen oder Streamingportalen eingibt, wird zugeschüttet mit Compilations von Kuschelrock bis zum offiziellen Sampler für das bescheuerte Reality-TV-Format »Bachelorette«.
Dazwischen versteckt liegt derweil ein musikalischer Schatz. [Kurz eingeworfen: Der Bindestrich bei Love-Songs hilft in dem Falle gelegentlich bei der schnelleren Orientierung!]
Das Trio, bestehend aus Manuel Chittka (drums), Thomas Korf (electronics und vox) und Sebastian Kokus (bass), ist womöglich gar keins. Denn ihre Musik ist immer wieder durch Kooperationen und Gastmusiker*innen aufgewühlt worden. Am prominentesten vielleicht von Ulf Schütte (Datashock / Phantom Horse), der auf ihrer letzten LP für das Hamburger Label Bureau B gleich mitgenannt wird. »Spannende Musik« ist sogleich auch ein Versuch, das eigene Bandgefüge weit zu öffnen, ein Tor aufzumachen und Einflüsse fließen zu lassen.
»Ich will immer nur eins. Ich kann immer nur eins. Ich sag immer nur eins. Ich mach immer nur eins …«
Aber gehen wir nochmal einen Schritt zurück: Schon von Anfang an kümmerten sich Chittka, Korf und Kokus wenig um Trends und arbeiteten selber an einem charakteristischen, idiomatischen Love-Songs-Sound. Spuren dieses Sounds sind zu lesen: Man landet beim dichten Kosmischen Kraut eines Günther Schickert, der seine Erkenntnisse aus der Berliner Free Jazz-Szene auf elektronische Produktionen übertrug. Man landet ganz sicher auch bei Palais Schaumburg und ihrem in der ersten Inkarnation für deutsche Ohren (trotz Landessprache) etwas zu internationalem Gesang. Wohlfeile Vergleiche zu Rheinland-Kraut-Koryphäen hingegen verbieten sich – man lugt womöglich eher nach München und zur Hippie-Kombo Embryo. Auch hier wieder Jazz-Wurzeln, nur mal so eingeworfen.
Für die letztgennannte Traditionslinie sprichen die Durchlässigkeit für Einflüsse und der bereits erwähnteVerbündungswillen: Zusammen schafft man meist mehr als alleine. Und so blickt man auch über den eigenen Tellerrand hinaus. Bestes Beispiel wäre die Zusammenarbeit mit der Albanerin Hava Bekteshi.
Hier trifft die Eigenheit des Love-Songs-Klangs auf eine lange, folkloristische Tradition, die sich in der Musik der Sängerin Bekteshi wiederfindet und aktualisiert. Gemeinsam landet man bei einem verdichteten Sound-Universum, das sich innerhalb von Minuten ausbreitet, einkerbt und leise verschwindet – nicht ohne Nachhall in Kopf und Geist.
Mit diesem Nachhall ist man immer wieder konfrontiert, wenn man sich durch die Musik des Trios klickt (ein Großteil ist vornehmlich digital erschienen) oder wenn man die Platten auflegt: Manchmal findet man dieses Echo IN den Tracks. Dann passiert etwas im Off-Beat, eine eigenwillige Dub-Interpretation taucht auf. Ein andermal wiederum erscheinen diese Echospulen AUSSERHALB der Tracks, worauf sich einzelne Zeilen, die Sprechgesangs-Spezialist Korf meist in gekonnter Neutralität ins Mikro schiebt, festsetzen und einnisten. »Ich will immer nur eins«, singt er etwa in dem fast 16 Minuten währenden Song »Inselbegabung«. Diese Zeile variiert er: »Ich kann immer nur eins, Ich sag immer nur eins, Ich mach‘ immer nur eins …«
Wie ein treuer Begleiter heftet sich diese Zeile an die Fersen der Hörer*innen: Bleibender Eindruck. Wenn ein Gedanke einen Verstand erstmal infiziert, ist es fast unmöglich ihn zu entfernen. Virale Musik.
Bis sie da ankommen, vergehen Minuten. Keinesfalls zu viele; der Track ist austariert bis ins Kleinste. Mit seinen Glockenklängen zu Beginn ruft er sakrale Zusammenhänge auf. Langsam schieben sich eine Klarinette und eine Querflöte ins Bild; sie verlassen die Kirche und weisen eher auf grüne Auen. Spiritualität kann an jedem Ort herrschen. Ein Bass, ein Schlagzeug, mehr synthetische Klänge: Jetzt erst treten die Love-Songs voll auf. Da sind schon vier Minuten ins Land gegangen, auch wenn es ob der Kurzweiligkeit niemand mitbekommen hat.
Das Trio Love-Songs wird auch im King Georg nicht zu dritt auftreten; wie passend. Fion Pellacini wird mit seiner Klarinette für diese eine Nacht Teil der Band. Steigt ein in den Kosmos und erweitert ihn. So wie man es von echten Love-Songs kennt. Für Liebesschmonzetten von Mark Forster und Konsorten würde ich hingegen nicht meine Hand ins Feuer legen.
Text: Lars Fleischmann. Foto: Natalia Sidor

Die Saxofonistin Karolina Strassmayer und Schlagzeuger Drori Mondlak haben unter dem Bandnamen Klaro! schon eine Reihe von Alben herausgebracht – dieses ist anders. Schon das erste Stück »Sing to Me of …«, ein Duo der beiden, stellt Mondlaks Perkussion viel stärker in den Vordergrund und ist musikalisch freier als die Vorgängeralben. Für »Mallets and Air« greift Karolina Strassmayer zur Flöte und spielt berückend schöne Töne über Mondlaks düsteren Trommeln und den Einwürfen von Pianist Rainer Böhm. In »Sticks and Flurries« hat Böhm mehr Raum, den er zu einem pointillistischen Solo über Mondlaks Besenarbeit nutzt, bevor Karolina Strassmayer ein lautmalerisch expressives Flötensolo beginnt. In »Brushes Dancing« solieren Strassmayer und Böhm melodisch über Mondlaks virtuos »tanzenden Besen«. In »Courage« greift Bassist Thomas Stabenow stärker ins Geschehen ein in einer längeren Trio-Passage mit Böhms fließenden Läufen, dann setzt Strassmayer zu einem immer intensiver werdenden Solo am Altsaxofon an, ihrem Erstinstrument. Stabenow leitet »aahhh!« mit einem Basssolo ein, alle vier machen dieses längste Stück dann zum stärksten Quartettstück des Albums. Mit »Freescapes« haben Drori Mondlak und Karolina Strassmayer eine neue Stufe ihres Musikerlebens erreicht. Sehr freie Improvisation, nicht im Sinne des Free Jazz, sondern inside, also innerhalb eines Harmoniegerüsts. Faszinierend – und ein Kandidat für die Bestenliste 2022!
Text: Hans-Bernd Kittlaus
Der Titel der 2020 erschienen CD unseres Gastes der kommenden Woche Joe Haider mit seinem Sextett, insbesondere dem Trompeter Heinz von Hermann, erinnerte mich an diese Melodie. Wer könnte besser mit diesem Titel gedanklich spielen als die beiden 86jährigen Meister des Jazz ?! (siehe hierzu unseren Beitrag von Lars Fleischmann »Im besten Alter«)
Denn zu deren Geburtszeiten erblickte auch dieser Boadway-Song aus dem Musical »Everybody´s Welcome« das Licht der Welt: 1931 von Herman Hupfeld, bekannt geworden 1942 durch den Film-klassiker »Casablanca«. Man mag gar nicht die beste Version auswähle, so oft ist der Song gespielt worden. Neben Frank Sinatra:
Natürlich Ella Fitzgerald (1970):
oder Billie Holiday
oder auch Brian Ferry (1999):
Aber nichts führt an »Casablanca« vorbei: Das ist eine Jahrhundertszene… damals wie heute…
Und dazu gehört dann auch der Text, dessen Refrain viele auswendig kennen werden:
You must remember this
A kiss is just a kiss
A sigh is just a sigh
The fundamental things apply
As time goes by
And when two lovers woo
They still say „I love you“
On that you can rely
No matter what the future brings
As time goes by
Moonlight and love songs
Never out of date
Hearts full of passion
Jealousy and hate
Woman needs man, and man must have his mate
That no one can deny
It’s still the same old story
A fight for love and glory
A case of do or die
The world will always welcome lovers
As time goes by
Moonlight and love songs
Never out of date
Hearts full of passion
Jealousy and hate
Woman needs man, and man must have his mate
That no one can deny
It’s still the same old story
A fight for love and glory
A case of do or die
The world will always welcome lovers
As time goes by
Zurück zu Joe Haider und seiner Band: Hier eine Aufnahme aus 2020 (Genf) mit den Songs
Magic Box (Bert Joris)
Only For You (Joe Haider)
As Time Goes By (Hermann Hupfeld) (ab 6:00)
Hot Summer In Vienna (Johannes Herrlich)
in der Besetzung
Joe Haider, piano
Bert Joris, trumpet & flugelhorn
Heinz von Hermann, tenor saxophone & flute
Johannes Herrlich, trombone
Raffaele Bossard, upright bass
Dominic Egli, drums & cymbals
(übrigens mit einer Ausnahme „unsere Besetzung kommende Woche!)
Und gerne noch ein Beispiel der aktuellen Kunst von Joe Haider and friends:

Jochen Axer, Unterstützer des King Georg und über die Cologne Jazz Supporters Förderer vieler weiterer Jazz-Projekte, stellt hier jeden Sonntag einen seiner Favoriten vor.
Die Karriere des Joe Haider ist ein vielschichtiges Stück Jazzgeschichte, das der Pianist, Komponist und Arrangeur bis in die Gegenwart und auch mit 86 Jahren auf der Bühne voller Inspiration und Spielfreude fortsetzt.

Man kennt den Topos aus Hollywood nur zu gut. Allenthalben entstehen dort Filme, wo ein reiferer Herr, oder gar eine ganze Gruppe Best-Ager zu Höchstleistungen getrieben werden. Diese Helden werden entweder von Clint Eastwood oder von Tommy Lee Jones gemimt. Und im Zweifel retten sie am Ende die Welt.
Da ist man doch gleich zweimal froh, dass das Wissen der Älteren in bestimmten musikalischen Kreisen eine Normalität ist und nicht extra verfilmt werden muss. Nein, Gesellen wie Marshall Allen und Sonny Rollins zeigen immer wieder und unlängst, dass man im Jazz nicht nur gut altern kann, sondern der Jazz auch gut mit einem reift.
Ein anderes Beispiel: Der 1936 in Darmstadt geborene Joe Haider.
Sitzt, wackelt und hat Luft – nur nicht nach oben!
Jederzeit bereit, auch drei Abende in Folge zu spielen (wie von 16. – 18.5.22 bei uns im King Georg), zeigt sich der renommierte Pianist, Komponist und Arrangeur immer noch in Bestform.
Über den Umweg Stuttgart und eine Ausbildung als Kaufmann, zog es ihn 1960 nach München. In der damals aufkeimenden und schon bald florierenden Szene der Isar-Metropole fühlte sich Haider ausgesprochen wohl, und ein gleichzeitig begonnenes Studium am Trapp’schen Konservatorium (das heutige Richard-Strauss-Konservatorium) verlief auch ganz nach Wunsch, sagt die Geschichtsschreibung. Neben Klausuren und Vorspielen wurden alsbald die Bretter, die die Welt bedeuten, umso wichtiger. Haider machte sich schnell einen Namen und spielte groß auf. Zwischen 1965 und 1968 war er Pianist des Haustrios des gerade eröffneten und alsbald legendären Domicile.
Hier traf er mit Größen des Geschäfts und der Kunst zusammen: Albert Mangelsdorff, Dusko Goykovich, Klaus Doldinger, Benny Bailey – um nur ein paar zu nennen. Er nennt es heute ein »Konservatorium neben dem Konservatorium«. Man spielte jeden Abend. Manchmal nach Lead Sheets, dann wiederum nach Gehör.
Etwas später, 1974, entstand an der gleichen Stelle eine legendäre Aufnahme: »Give Me A Double« des Slide Hampton-Joe Haider Jazz Orchestra. Mit bereits genannten Benny Bailey, dem legendären Idrees Sulieman (man denke bloß an seine Arbeit mit Mal Waldron) als zweitem Trompeter und natürlich Isla Eckinger am Bass.
Die atemberaubende Aufnahme ist tatsächlich auch heute noch zu erschwinglichen Preisen zu erstehen, wenn man den Plattenmenschen seines Vertrauens fragt. Das eindeutig zweideutige Cover gibt die flirrende Erotik und körperliche Präsenz schon Preis. Das von Joe Haider komponierte »Tante Nelly« nimmt hier eine herausragende Rolle ein: Ein fanatischer Big Band-Sound, klare Vorgaben, viel Platz für die schwindelerregenden Soli, Ack van Rooyen am Flügelhorn, afrokaribischer Charme in den Keys – mit einer fast schon spirituellen Energie spielt sich die Band in einen Rausch. Sitzt, wackelt und hat Luft – aber ganz sicher nicht nach oben!
Blindes Verständnis, intensive Zeit
Das blinde Verständnis von Haider und seinem Bass-Mann Eckinger ist erstaunlich, verwundert allerdings nicht mehr so sehr, wenn man bedenkt, dass die beiden tatsächlich schon jahrelang nahezu täglich zusammenspielten – gemeinsam in der Schweizer Band Four for Jazz (mit Heinz Bigler und Peter Giger), sowie im mittlerweile zweiten Joe Haider Trio. Dazu eben an der Seite anderer Größen.
Eine intensive Zeit, die Haider Mitte der 1980er langsam in eine andere Phase überführte. Hier übernahm er dann die Leitung der Swiss Jazz School in Bern. Nicht ohne Grund legt Haider heute noch Wert darauf, auch »Pädagoge« zu sein. Unter seiner Leitung nahm das Renommee der Schweizer Schule enorm zu.
Daneben tourte er stets weiter. In verschiedenen Konstellationen ging es durch die Lande: Trio, Quintett, Sextett, Soul Group, Nonett, Big Band und Orchester. Haider komponierte und arrangierte für jede Größe.
Seinen eigenen Kompositionen schenkte er dabei das gleiche Maß an Aufmerksamkeit wie alten und neuen Standards. So sind bis heute die Kompositionen eines Thelonious Monk für ihn geschütztes Kulturgut.
Schon 1971 zeigt er mit seiner Gruppe Four for Jazz ein ausgesprochenes Interesse an der Harmonik Monks. »Flames Of Life« heißt das Stück und klingt so:
1995 endete dann sein Engagement an der Berner Hochschule – still wurde es aber auch damals nicht um ihn. Hervorzuheben ist etwa die elf Jahre währende Zusammenarbeit mit dem Brigitte Dietrich Jazz Orchestra (ab 2000), oder erst unlängst Joe Haider Jazz Orchestra & The Sparklettes »Back to the Roots« von 2018.
Stargast Heinz von Hermann
Ein Einblick in seine eigene Geschichte und Sozialisation mit Swing, Blues und Bop wird hier gegeben. Trotz Nonett-plus-Vokalgruppe-Line-Up gelingt ein intimes Gespräch mit den Hörer*innen – über die Vergangenheit, erste Liebe und den immerwährenden Hang zur Leichtigkeit.
Gleicher Jahrgang wie Haider ist übrigens der zweite Stargast der drei King Georg-Abende, Heinz von Hermann, ebenfalls 1936 geboren. Nur nicht in Darmstadt, sondern in Wien. Von da aus lernte er Geige, bevor er sich der Klarinette zuwandte. Saxofon und Flöte brachte er sich dann gleich auch selber bei. Von Hermann spielte einst bei Max Greger und Paul Kuhn, zwischenzeitlich auch mit Dusko Goykovich in der Munich Big Band. 1996 gründete er dann mit dem King Georg-Session-Host und Kölner Hochschulprofessor Andy Haderer das Quintett Jazzahead.
Für Haider und von Hermann gilt: Es braucht keine große Hollywoodverfilmung ihrer Taten im fortgesetzten Alter. Den wahren Spielfilm kann man jeden Abend erleben. Wenn sie das machen, was sie am besten können: Jazz spielen!
Text: Lars Fleischmann
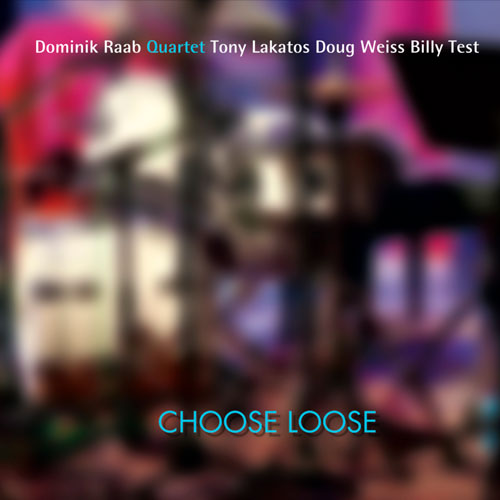
Der Schlagzeuger Dominik Raab, wiewohl erst Anfang 30, hat sich in den letzten Jahren in die erste Liga der deutschen Straight Ahead Drummer vorgearbeitet. Das vorliegende Album demonstriert zudem seine beachtlichen Fähigkeiten als Komponist mit acht Stücken aus seiner Feder. Der Titelsong besticht mit seiner warmen einnehmenden Melodie, die von Tony Lakatos auf dem Tenorsaxofon intoniert wird, bevor Pianist Billy Test das Stück interpretiert. Lakatos soliert immer intensiver, dann setzt Bassist Doug Weiss zu einem ruhigeren, aber ausdrucksstarken Solo an. Für »Cringe Worm« greift Lakatos zum Sopransaxofon und soliert Coltrane-esk über dem treibenden Rhythmus von Raabs Becken. Die Melodie erinnert wohl nicht ganz zufällig an Frank Loessers »Inchworm«. Die Ballade »Kind Mind« erfährt eine höchst gefühlvolle Interpretation mit einleitendem Solo von Test, ruhigem Spiel von Lakatos und melodischer Improvisation von Weiss über Raabs zurückhaltendem Rhythmus. In »Boss Gloss« und »Pneu à Pneu« geht es dann wieder voll swingend zur Sache. Dieses Album macht von Anfang bis Ende Spaß – zum Wohlfühlen auf hohem musikalischen Niveau.
Text: Hans-Bernd Kittlaus
Die Saxofonistin Theresia Philipp im Porträt – und im Gespräch über Gender Equality in der Jazz-Szene.

Als Theresia Philipp und ich uns das erste Mal im Winter 2020 treffen, kommen wir alsbald auf das Thema »Geschlechter-Gleichberechtigung im Jazz« zu sprechen. Im Innenhof der Alten Feuerwache, unweit vom King Georg entfernt, sprechen wir über die Studie der Union Deutscher Jazzmusiker – die in der Zwischenzeit und als Konsequenz umbenannt wurde in Deutsche Jazzunion – und darüber, dass immer noch Instrumentalist*innen in der absoluten Minderzahl gegenüber ihren cis-männlichen Pendants sind. Das sei vor allen Dingen auch eine Frage oder ein Problem in Köln und anderen Städten Westdeutschlands.
Theresia Philipp wurde 1991 in Großröhrsdorf in Sachsen geboren, begann mit sieben am Keyboard zu spielen, wechselte mit zehn ans Saxofon und spielte fortan auch im Spielmannszug – mit allem Drum und Dran: »Es gab richtige Marschformationen, mit Figuren und Mustern, wie man es aus dem Fernsehen kennt.« In der achten Klasse zog es sie an das höchst renommierte Sächsische Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber in Dresden – ein Konservatorium in der Tradition der DDR-Musikschulen inklusive Internat. Harmonielehre, Klavier, Saxofon und natürlich der klassische Abiturstoff. Ein ganz schöner Drill, der sich bald auszahlen sollte.
Zwischen 2007 und 2011 gehörte sie zum LandesJugendJazzOrchester Sachsen, danach zum BundesJazzOrchester (BuJazzO). Zwischendrin beobachtete sie Unterschiede zu ihren Jazzkolleg*innen aus dem Westen: »Was das Thema Gleichberechtigung bei der Musikerziehung und –förderung anbelangt, ist der Osten immer noch sehr viel weiter. Der berufliche Werdegang ist dort viel weniger bestimmt durch das eigene Geschlecht – das kann man auch an mir sehen. Es war in Sachsen viel normaler, dass Mädels und Jungs zusammen Musik lernen und spielen.«
Zum Studium kam sie an den Rhein, an die Hochschule für Musik und Tanz. Mittlerweile ist sie eine feste Größe in der Szene der Stadt, spielte schon in etlichen Formationen und mit allen möglichen Musiker*innen. Das bescherte ihr 2020 bereits das Horst und Gretl Will-Stipendium für Improvisierte Musik und Jazz der Stadt Köln, womit sie Koryphäen des Fachs wie Hayden Chisholm oder Philip Zoubek beerbt. So hieß es damals auch in der Begründung: »Theresia Philipp bewegt sich kompositorisch mittlerweile souverän in verschiedenen Epochen und Stilformen. Ihr aktuelles Projekt verbindet orthodoxe Kirchenmusik mit westeuropäischer Alter Musik und zeitgenössischer improvisierter und komponierter Neuer Musik, ohne dass diese vier Welten sich dabei im Wege stehen.«
Es war in Sachsen viel normaler, dass Mädels und Jungs zusammen Musik lernen und spielen
Theresia Philipp
Das Projekt heißt »Pollon with Strings« und erschien auf dem Label Float. Während Pollon ein eingespieltes Trio aus Philipp, Thomas Sauerborn und David Helm darstellt, konfrontiert sie diese Einheit mit einem Streichertrio aus der Nica-Stipendiatin Elisabeth Coudoux, Radek Stawarz, den man unter anderem aus dem Rundfunk Tanzorchester kennt, und Axel Lindner. »Ich setzte hier voll auf die musikalische Weitsicht und das Improvisationsvermögen der Musiker*innen. Ich habe die individuellen musikalischen Charaktere einem klassischen Streichquartettsound vorgezogen.«
Daneben spielt sie auch Saxofon und Klarinette für die Band BÖRT. Dann gab es die Platte »Losing Color« des Trios Philipp / Sauerborn / Dumoulin beim Kölner Label Klaeng. Darauffolgend spielte sie letztes Jahr beim Klaeng-Festival die Premiere ihrer interdisziplinären Komposition »Ain’t I«. Es ist ein politisches Projekt, das schon länger in Vorbereitung war. Bereits 2020 erzählte sie mir von »Ain’t I« und dass sie dafür Texte des intersektionalen feministischen Linken lese und sammle. Benannt ist das Projekt auch nach einer Rede der Anti-Sklaverei-Ikone Sojourner Truth: »Ain’t I a Woman« fragte sie 1851 ihr Publikum. Für Philipp ist es besonders wichtig, ihre Kunst mit politischen Aussagen und Problemstellungen zu verbinden.
Theresia Philipp erzählte mir auch von eigenen Zweifeln, die sie als Musikerin, im Speziellen als Saxofonistin, früher begleitet haben: »Wenn man anfängt als Frau mit dem Saxofon, dann sind die Vorbilder rar gesät. Heutzutage ist das schon anders, aber damals entdeckte ich Candy Dulfer und musste feststellen, dass sie schon einen anderen musikalischen Ansatz als ich hat. Erst Karolina Strassmayer zeigte mir, dass es für Saxofonistinnen einen Ort und Platz in der Szene gibt.« Für Stunden bei der ersten festangestellten Frau in der WDR Big Band fuhr sie einst durch die gesamte Republik – von Ost nach West.
Dass sich aber langsam etwas tut, spürt man an allen Ecken in der Jazz-Szene, auch wenn man sich Philipps Erfolge anschaut. So erntet sie derzeit die längst verdienten Lorbeeren, gewann dieses Jahr schon den renommierten WDR Jazzpreis in der Kategorie Komposition – und war 2022 nominiert für den Deutschen Jazzpreis (ehemals Jazz-Echo) in der Kategorie Saxofon.
Also alles in Ordnung? Nicht ganz. Noch immer sind Frauen in der Unterzahl – bei Instrumenten wie Drums, Percussions, den meisten Blechbläsern, aber selbst bei vermeintlich »weiblich konnotierten« Instrumenten wie der Flöten-Gruppe, muss man Frauen lange suchen. Je höher die Weihen, desto dünner wird das Feld. Die Anfänge sind gemacht, aber dennoch gibt es keinen Grund sich auszuruhen.
Text: Lars Fleischmann, Foto: Lukas Diller