»Rhythmus ist unbegrenzt«
In einer Stadt voller grandioser Pianist*innen konnte sich der gebürtige Saarländer Felix Hauptmann eine herausragende Rolle erspielen. Wir sprachen mit ihm über seine Band Percussion.
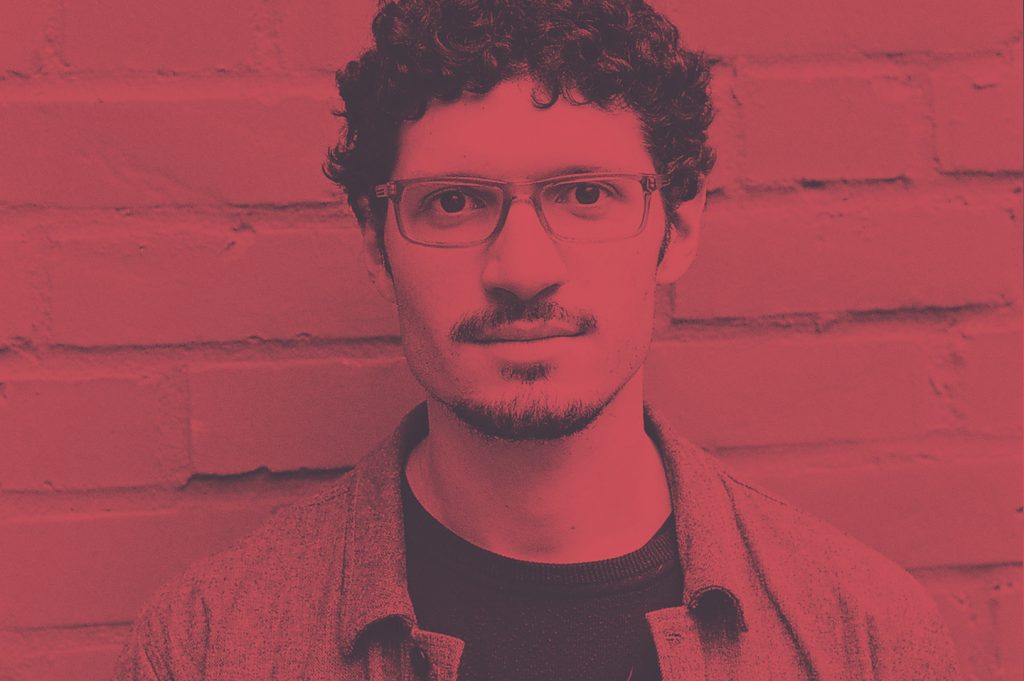
Der Preisträger des Horst und Gretl Will-Stipendiums für Improvisierte Musik der Stadt Köln 2022 ist ein hoch-aktiver Part der hiesigen Szene – als Komponist, Musiker, Dozent und Veranstalter. In der Jury-Begründung heißt es dazu: »Als Pianist ist er ein hellhöriger Sideman, als Solist und Komponist arbeitet er nachdrücklich und kreativ an der Findung und Erfindung eigener Wege. Seine kompositorische Handschrift ist geprägt von einer erstaunlichen Vertrautheit mit Kompositionsweisen zeitgenössische E-Musik, […]“ Diese Vielseitigkeit zeichnet Hauptmann seit mehreren Jahren – er kam bereits 2012 nach Köln zum Studium an die Hochschule für Musik und Tanz – aus und spiegelt sich in seiner eigenen Musik wider, die nicht bloß nach Diktaten oder Maximen funktioniert, sondern sich in einem steten Wandlungsprozess befindet.
Im Dezember letzten Jahres spielte er mit seiner Band Percussion – mit Roger Kintopf am Kontrabass und Leif Berger am Schlagzeug – im King Georg. Das Video des Auftritts könnt ihr euch hier anschauen.
Deine professionelle Karriere begann sehr früh. Deine erste Duftmarke hast du mit dem HNK Trio gesetzt, da warst du noch lange nicht volljährig. Wie kam es dazu?
Über meinen damaligen (Jazz-)Klavierlehrer aus dem Saarland, Christoph (»Sunny«, Anm. d. Aut.) Mudrich, der sehr gut vernetzt war, kam es zu dieser Verbindung. Er hat sehr viele Workshops gegeben und wahnsinnig viel unterrichtet, kannte deswegen sehr viele (Hobby-)Musiker*innen. Als er merkt, dass das bei mir in eine gewisse, professionellere Richtung gehen könnte, hat er sich im Saarland umgeschaut nach Leuten, mit denen ich eine Band gründen könnte. Er fand dann Conrad (Noll) und Fabian (Künzer). Als wir dann merkten, dass wir nicht nur Standards spielen wollten, sondern auch selbst etwas schreiben wollten, fing die Band an zu arbeiten. Da war ich 16 als es ernster wurde.
2011 habt ihr dann den Studiopreis des Deutschlandfunks gewonnen. Fühlt man sich da wie ein Wunderkind?
Nee, wie ein Wunderkind habe ich mich nie gefühlt. Dafür war das auch viel zu weird. Der Wettbewerb war in Dortmund und das war der erste Wettbewerb, den ich gespielt habe. Ich hasse Vorspiele und Wettbewerbe – heute zumindest. Aber damals waren wir da, weil es auch keinen anderen Bewerber aus dem Saarland gab. Es hieß »Entweder fahrt ihr hin oder keiner«. Als wir dann ankamen, ohne Vorausscheid oder ähnliches, und hörten auf welchem Niveau dort gespielt wurde, war für uns klar: Da ist nichts zu holen. Einige andere Bands waren schon älter, waren teilweise schon im Studium. Wir haben uns dann sehr gefreut als wir tatsächlich gewonnen haben.
Aber das hat nicht dazu geführt, dass ich mich jetzt herausragend fand. Ich wurde immer sehr unterstützt, das ist super schön. Als Wunderkind habe ich mich dennoch nie gefühlt.

Dein Instrument, wenn wir es mal als Pianoforte nehmen, dann ist es vermutlich das weitverbreitetste oder bekannteste Instrument der Welt …
… der westlichen Welt …
… genau, der westlichen Welt sein den 1830ern. Aber da hat es mit der Gitarre die Musik am meisten beeinflusst. Deswegen ist es auch am besten untersucht, es wurde darauf alles gemacht, würde ich behaupten. Ist dieses inhärente Erbe grundlegend für deine Arbeit als Pianist?
Für mich bedeutet es eine gewisse Freiheit, dass schon alles gespielt wurde, schon jede Verbindung und jeder Akkord gespielt wurde. Ich kenne nicht so viel Musik, im Vergleich zu anderen Menschen, aber ich habe eine gewisse Sicherheit, dass wirklich alles schon einmal gespielt wurde. Das muss gar nicht groß das Licht der Welt erblickt haben oder hier, in Deutschland, angekommen sein – für mich ergibt sich daraus eben kein Auftrag etwas »Neues« zu schaffen. Darum geht es mir nicht. Wenn ich sowieso nicht das Rad neu erfinden muss, dann kann ich mich ja darauf konzentrieren, was ich spielen und erforschen will.
Anders ist es zum Beispiel, wenn auf der Bühne ein Instrument gespielt wird, das man hier nicht kennt: Da ist man erstmal mit dem Klang beschäftigt und vielleicht gar nicht so sehr mit dem, was gespielt wird.
Trotzdem versuchst du das Vokabular der Tasteninstrumente zu erweitern. Du widmest dich ja auch der Analog-Synthese. So steht es in der Begründung zum Kölner Horst-und-Gretl-Will-Stipendium…
Naja, partiell widme ich mich der Analog-Synthese. Ich finde es etwas amüsant, dass das dort als erstes angeführt wird. Es gibt nämlich Kolleg*innen, die sich dessen schon viel mehr angenommen haben. Ich würde für mich nicht behaupten, dass ich mich damit »beschäftige«.
Ich benutze den Synthesizer und habe erst letzte Woche auch eine Synthesizer-Session mit meiner Band Percussion gemacht, aber da erschöpft es sich schon.
Von daher gibt es ein Album von mir, »bloom (night)«, das habe ich zu Hause aufgenommen mit Synthesizern. Das ist aber auch nur auf Bandcamp und nie groß erschienen.
Der Groove ist wichtig
Ich frage mich, ob du gerade dabei bist gewisse Sackgassen in der am Klavier gespielten Jazz- und Improvisierten Musik (für dich) aufzulösen.
Diese Sackgassen liegen nicht am Instrument, sondern wenn an mir.
Und dennoch widmest du dich eindeutig mit deiner Band Percussion der Rhythmik, was ja das neue Forschungsfeld der Musik darstellt, nachdem in den letzten Jahren Harmonik auf die Spitze getrieben wurde und ausformuliert scheint.
Ja, voll. Das ist natürlich der Grundgedanke. Der Name Percussion ist da auch on the nose. Der ergab sich aus Stücken, die ich mal gemacht hatte und dann nur »Percussion 1« etc. nannte. Nachdem ich »Talk« rausgebracht hatte, war das ein schöner Moment. Ich war sehr zufrieden und konnte trotzdem sagen, dass ich diese Musik erstmal nicht mehr spielen mag.
Woraus ergab sich dieses Gefühl?
Wenn man in Köln Klavier studiert, dann muss man wirklich alles gecheckt haben. Das Niveau ist extrem hoch. Und gerade, was Harmonik angeht, gibt es einen subtilen Druck, den man verspürt, während des Studiums. Ich wollte aber dann irgendwann etwas anderes machen. Und die schnellste und interessanteste Alternative dazu war Rhythmus. Ich bin sowieso Fan: Wenn es nicht groovet, dann ist es eh auch Quatsch …
Und nach einem Gespräch mit Leif (Berger, Drummer bei Percussion) im Zug, wo wir über Köln und das Niveau in der Stadt gesprochen haben, war klar: Harmonie bleibt dann letztlich ein begrenztes Feld im Zwölfton-System. Und Rhythmus ist unbegrenzt. Leif meinte, dass er es komisch finde, wie wenig da der Fokus drauf sei. Das war der Auslöser, um bei der Rhythmik tiefer einzusteigen.
Was ist die Idee bei Percussion?
Im Prinzip beruht die Art zu spielen allein auf den Stücken. Wir haben an dem Donnerstag, als wir im King Georg gespielt haben, 11 oder 12 Stücke gespielt. Das meint man vielleicht gar nicht, aber wir spielen vornehmlich Stücke, auch wenn die frei klingen. Wir haben extrem viel Material. Es gibt improvisierte Passagen, aber der Großteil ist komponiert.
Das überrascht tatsächlich. Weil ihr drei in eurer Spielweise sehr frei wirkt…
Weil wir es auswendig gelernt haben. Das ist ein großer Punkt. Das Material zu lernen hat ewig gedauert, weil es so umfangreich ist. Das ist mit Abstand die Band, mit der ich am meisten geprobt habe. Wenn wir einen Gig spielen – abgesehen jetzt von Touren -, dann müssen wir uns vor jedem Konzert wieder treffen.
Das ist für mich der Kern dieses Projekts: Die Musik ist natürlich sehr kompliziert, aber die Komplexität ist kein Selbstzweck, sondern nur Vehikel für eine arbeitende Band. Ich wollte einen Grund haben, um viel zu proben.
Ich denke immer: Die Musik ist so weird und schwierig, dass man sich fühlt wie bei der ersten Garagenband, wenn man versucht Pop-Songs zu covern, obwohl man nicht wusste, wie das Keyboard angeht. Und dann schafft man sich das drauf. Und genau dieser Vibe ist für mich Percussion.
Das bedeutet aber auch viel reinstecken …
Ja, genau. Es gibt manchmal so Hochnäsigkeiten. Da sagt man eine Komposition sei »kacke«, wenn man nach einer Probe keine Lust hat, ein Stück zu spielen. Ich denke, dass man bei den Privilegien, die wir hier genießen, dann muss da auch etwas mehr hinter stecken. Ich kann Musik machen nicht mehr angehen nach dem Motto: »Ich kann eh alles spielen und etwas, was mir nicht gefällt, lasse ich halt.« Percussion ist das Gegenteil: Die Kompositionen müssen erarbeitet werden.
Ich habe mich immer weniger damit gut gefühlt, in einem Land wie Deutschland zu leben und für mich ist alles easy, ich habe keine existenziellen Sorgen, und mich dann hinzusetzen und zu zocken. Das ist doch nicht nachhaltig, wo soll das hinführen.
Ich stehe gar nicht mehr auf dieses »Man kommt wohin und dann spielt man was weg«. Ich komme da ja her, aber das ergibt für mich und die Band keinen Sinn mehr. Ich habe mich immer weniger damit gut gefühlt, in einem Land wie Deutschland zu leben und für mich ist alles easy, ich habe keine existenziellen Sorgen, und mich dann hinzusetzen und zu zocken. Das ist doch nicht nachhaltig, wo soll das hinführen.
Das ist sehr anti-genialistisch und anti-romantisch.
Ja, das ist doch gut. Ich bin total froh, dass die Bandmitglieder bei Percussion, aber auch die Musiker*innen in den anderen Konstellationen, in denen ich spiele und arbeite, das genauso sehen. Da wird wahnsinnig viel geprobt und gesprochen, reflektiert und gezweifelt.
Du bist Lehrbeauftragter in Wuppertal an der Bergischen Hochschule … Was bringst du deinen Student*innen bei?
Ich kann den Student*innen sowieso nicht viel »beibringen«. Auch wenn mein Lehrauftrag »Jazz-Piano« heißt, lehre ich im Studiengang fürs Lehramt. Ich unterrichte also keine angehenden Berufsmusiker*innen, sondern jene, die später an den Schulen selbst unterrichten wollen. In den wenigsten Fällen geht es um Jazz-Klavier spielen. Es geht eher um konkrete Sachen: Wie kann ich einen Song arrangieren? Wie begleite ich Schüler*innen, wenn die auch mal etwas anderes probieren wollen als es der Lehrplan vorgibt? Es geht mir um das Vermitteln einer grundsätzlichen Flexibilität. Ich sehe mich eher als jemand, der Hilfestellungen gibt.
Nimmst du denn etwas mit für deine eigene Musik und Kompositionen?
Bisher nicht. Das liegt daran, dass ich schon sehr lange an meiner Musik arbeite und diese weit weg davon ist, was die Student*innen jetzt selbst interessiert. Mir nützt aber dennoch, dass ich schon so viel über Musik und meine Musik – was immer das im Detail heißen soll – nachgedacht habe. Was schon vorkommt: Ich höre Songs, die ich nicht kannte, aber cool finde. Das nehme ich mit. Und ich sehe und höre, was die noch jüngeren Menschen interessiert, mit welchen Problemen sind, die im Fach und generell konfrontiert … das sind zukünftige Lehrer*innen und ich bekomme einen Einblick, wie der Studiengang konzipiert ist und was demnächst gelehrt werden soll. Das versuche ich mitzunehmen …
Interview: Lars Fleischmann.